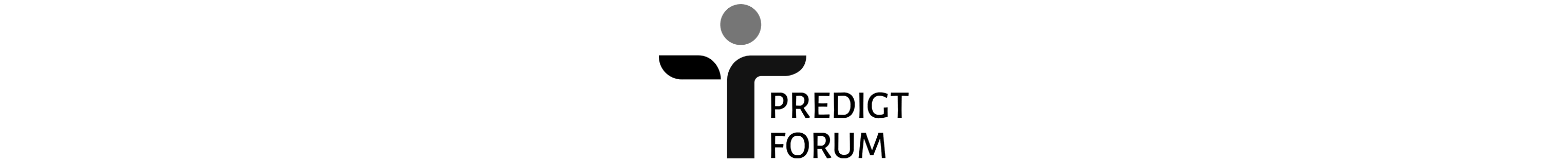Eine Option für die Fremden
Das globale Dorf
Für die Manager der Kommunikationsindustrie ist unsere Welt längst zum »globalen Dorf« geworden. Auf den DatenHighways sind Grenzen und unterschiedliche Kulturen keine unüberwindlichen Schranken mehr. Alle können mit allen kommunizieren. Wirklich? Das Surfen in den Datennetzen allein bringt es nicht. Wie es im globalen Dorf aussieht, zeigt sich überdeutlich mitten in Europa. Es ist noch nicht lange her, da endete in Sarajevo, einer europäischen Hauptstadt, das globale Dorf oft schon auf der anderen Straßenseite. Zwischen den Muslimen hier und den Serben dort gab es keine Kommunikation. Noch heute müssen bewaffnete Soldaten aus allen Teilen Europas und der USA darüber wachen, dass die Vereinbarungen von Dayton eingehalten werden. Und das in einer Stadt, die wie kaum eine andere Erfahrungen hat im friedlichen Zusammenleben verschiedener Volksgruppen und Kulturen. Wer vom neuen Europa spricht, muss Sarajevo im Blick haben. Er darf den Bruchstellen des globalen Dorfes nicht ausweichen.
Aber nicht nur in Sarajevo zeigen sich Hindernisse und Gräben zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Sie beginnen vor der eigenen Tür. Deutschland ist weltoffen offen vor allem für die Welt der Märkte und Produkte. Mit Menschen anderer Kulturen, soweit sie nicht nur auf Geschäftsreisen sind, tun wir uns sehr viel schwerer. Der Umgang mit Flüchtlingen beweist es. Wo die Integration nicht reibungslos klappt und Konfrontation droht, sortieren wir sie lieber wieder ein: Bosnische Flüchtlinge so schnell wie möglich nach Bosnien, Nigerianer am besten gar nicht nach Deutschland, Kurden nach Ostanatolien. Ist das die Vorbereitung auf eine Zukunft, in der nationale Grenzen an Bedeutung verlieren und sich im friedlichen Neben und Miteinander der Kulturen die Zukunftsfahigkeit unserer Gesellschaft erweist?
Wie soll die »Stammbevölkerung« in ihrem sozialen Selbstverständnis mit den anderen umgehen? Christliches Denken öffnet die Augen, durch das Anderssein des anderen hindurchzusehen auf das Gemeinsame. Die anderen sind Ebenbild Gottes wie wir. Trotz aller Unterschiede gehören wir zusammen. Diese universale Perspektive verpflichtet uns.
In letzter Zeit ist ein anderer Gesichtspunkt nach vorn gerückt, der zunächst wie ein Kontrapunkt wirkt. Gerade die Mitglieder der anderen Kulturen selbst weisen uns darauf hin, dass sie nicht nur als Gleiche respektiert werden möchten, sondern ausdrücklich auch als Andere. Sie möchten in unserer Gesellschaft ihre andere Auffassung vom Leben verwirklichen, ihre anderen Lebensformen wahren: Muezzinruf neben Glockenläuten, Ramadan neben Fastenzeit oder Schlankheitskur, Koranunterricht in der Schule. Traditionelle Stadtviertel bekommen ein exotisches Gepräge. Das alles führt zu beträchtlichen Schwierigkeiten im alltäglichen Leben, und es hat erhebliche Konsequenzen für unsere Vorstellungen vom Zusammenleben in ein und derselben Gesellschaft.
Eigentlich ist das Problem keineswegs so neu, wie viele meinen. 1993 hing im RömischGermanischen Museum in Köln ein großes Transparent: »Unsere ersten Kölner kamen auch aus Ägypten, Algerien, Belgien, Bulgarien, England, Frankreich, Griechenland, Italien, dem ehemaligen Jugoslawien, Libanon, Niederlande, Österreich, Spanien, Türkei.« Treffender lässt sich Unsinnigkeit der Volkstümelei mancher Stammtischredner kaum verdeutlichen. Freilich, es dreht sich hier offenkundig um ein Problem, das sich aus anderen Quellen speist als der des gesunden Menschenverstandes. H. M. Enzensberger hat das in seinem Essay »Die große Wanderung« an einer Alltagssituation veranschaulicht: Zwei Passagiere haben sich in einem Eisenbahnabteil häuslich eingerichtet und Tischchen, Kleiderhaken und sämtliche Sitze in Beschlag genommen. Da öffnet sich die Tür, und zwei neue Reisende treten ein. Die »Alteingesessenen« ärgern sich, denn sie betrachten das Abteil längst als »ihr Reich«, als ihr Territorium, das sie ganz für sich beanspruchen und nun auf einmal teilen sollen. Mit unverhohlenem Widerwillen räumen sie die freien Plätze und schieben die Gepäckstücke auf den Ablagen zusammen. Und dieser Widerwille gegen die »Eindringlinge« eint sie, obgleich sie sich untereinander nicht kennen, verwandelt sie fast in eine verschworene Gesellschaft, die sich gegen eine Gefahr »von draußen« zur Wehr setzen muss.
Diese gefühlsmäßige Reaktion und entsprechende Verhaltensmuster haben nichts mit Bewusstsein und verstandesmäßiger Überlegung zu tun, sie wurzeln vielmehr wie Enzensberger richtig vermerkt tief in unserem Unterbewusstsein. Indem wir uns instinktiv zusammenrotten, bannen wir unsere uralten Ängste gegenüber dem Unbekannten, dem Fremden. Aber wir zahlen einen Preis für unsere Sicherheit und Geschlossenheit, nämlich den Ausschluss der »ungebetenen Gäste«.
Dagegen erheben all jene Einspruch, die sich gegen Fremdenfeindlichkeit und für eine großzügige Asylpolitik einsetzen und sich dafür auf den Geist universaler Geschwisterlichkeit berufen. Sie haben sicher Recht, aber das entbindet sie nicht davon, sich der Frage zu stellen: Ist es denn nicht ein Widerspruch, die Fremden als Gleiche zu sehen und sie zugleich als Andere zu achten?
In der Tat: Wir sind in dieser Sache nicht nur herausgefordert, Fremde aufzunehmen, sondern darüber hinaus die anderen gerade in ihrem Anderssein anzunehmen. Minderheiten fühlen sich in den meisten Gesellschaften dem Druck ausgesetzt, als Preis der Akzeptanz durch die Mehrheit auf ihre kulturellen Eigenheiten zu verzichten zumindest auf solche, die der Mehrheit nicht gefallen. Die Eingesessenen vermitteln den Neuankömmlingen direkt oder indirekt, dass sie erst einen gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft einnehmen dürfen, wenn sie sich angleichen und kulturell integrieren lassen. Die Alternative Anpassung oder Ausweisung findet dann schnell eine breite Zustimmung, selbst bei denen, die sich als aufgeklärt und fremdenfreundlich geben.
Die eigene Tradition
Warum, so wird gefragt, soll eine Mehrheit, die schon lange hier lebt und ihre eigene kulturelle Tradition entwickelt hat, warum soll sie einwandernden Minderheiten ein Recht auf Entfaltung ihrer eigenen Kultur einräumen?
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Einheimische sich anderswo auch in der Situation einer Minderheit befinden und doch Wert darauf legen, die eigene Kultur leben zu können. Der Autoaufkleber sitzt: »Wir sind alle Ausländer, fast überall.« Was man für sich beansprucht, sollte man anderen nicht verweigern.
Aber es gibt noch ein gewichtigeres Argument. Unsere eigene Tradition verpflichtet uns, die anderen als solche zu respektieren. Gerade wer sich auf das Christentum beruft und in der Tradition des neuzeitlichen Humanismus stehen will, ist zur Toleranz gegenüber den anderen und zur Anerkennung ihrer Eigenart verpflichtet. Zugespitzt formuliert: Die Wurzeln unserer eigenen Kultur führen uns dazu, anderen Kulturen bei uns Freiraum zu schaffen.
Das heißt nicht, wir sollten die eigene Tradition verleugnen und alle Kulturen in einem »melting pot« zum Einheitsbrei zusammenrühren. Nicht der Schmelztiegel sollte das gesellschaftliche Leitmotiv sein, sondern eher der bunte Blumenstrauß. Es geht nicht um Gleichmacherei, sondern um das Miteinander von Verschiedenen im Rahmen einer staatlichen Verfassung.
In der Debatte um Multikulturalität gerät das Recht auf eigene Kultur nur allzu oft aus dem Blick. Zudem wird vergessen, dass man zum Eigenen stehen muss, wenn Vielfalt gedeihen soll. Und schließlich: Wie soll jemand die Identität eines anderen respektieren, wenn er selbst nie zur eigenen gefunden hat. Das gilt nicht nur für einzelne Personen, sondern auch für Völker.
Aus: Franz Kamphaus, Um Gottes willen - Leben. Einsprüche. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2004.