Die biblischen Lesungen wurden mit freundlicher Genehmigung der Ständigen Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen Bücher im deutschen Sprachgebiet den Lektionaren 2018 ff entnommen. - © 2024 staeko.net. - vgl. Impressum.
Die Katholischen Bibelwerke in Deutschland, Österreich und Schweiz stellen auf ihren Webseiten ausführliche Kommentare und Anleitungen zum Lesen der biblischen Lesungen für Sonn- und Feiertage zum Download im PDF-Format zur Verfügung. Mit freundlicher Genehmigung der Katholischen Bibelwerke übernehmen wir die Kurzeinleitungen zu den Lesungen.
Predigten vom 16. Apr. 2023 - 2. Sonntag der Osterzeit (A)

24. Nov. 2024
Christkönigsonntag (B)
17. Nov. 2024
33. Sonntag im Jahreskreis (B)
10. Nov. 2024
32. Sonntag im Jahreskreis (B)
03. Nov. 2024
31. Sonntag im Jahreskreis (B)
02. Nov. 2024
2. November: Allerseelen (A/B/C)
01. Nov. 2024
1. November: Allerheiligen (A/B/C)
27. Okt. 2024
30. Sonntag im Jahreskreis (B)
20. Okt. 2024
29. Sonntag im Jahreskreis (B)
13. Okt. 2024
28. Sonntag im Jahreskreis (B)
06. Okt. 2024
27. Sonntag im Jahreskreis (B)
29. Sep. 2024
26. Sonntag im Jahreskreis (B)
22. Sep. 2024
25. Sonntag im Jahreskreis (B)
15. Sep. 2024
24. Sonntag im Jahreskreis (B)
14. Sep. 2024
14. September: Kreuzerhöhung (Fest)
08. Sep. 2024
8. September: Mariä Geburt (Fest)
08. Sep. 2024
23. Sonntag im Jahreskreis (B)
01. Sep. 2024
22. Sonntag im Jahreskreis (B)
31. Aug. 2024
Erntedank (Sonst.)
25. Aug. 2024
21. Sonntag im Jahreskreis (B)
18. Aug. 2024
20. Sonntag im Jahreskreis (B)
15. Aug. 2024
15. August: Mariä Himmelfahrt (Fest)
11. Aug. 2024
19. Sonntag im Jahreskreis (B)
06. Aug. 2024
6. August: Verklärung des Herrn (Fest)
04. Aug. 2024
18. Sonntag im Jahreskreis (B)
28. Jul. 2024
17. Sonntag im Jahreskreis (B)
21. Jul. 2024
3. Sonntag im Juli: Heiligster Erlöser (Fest)
21. Jul. 2024
16. Sonntag im Jahreskreis (B)
14. Jul. 2024
15. Sonntag im Jahreskreis (B)
07. Jul. 2024
14. Sonntag im Jahreskreis (B)
30. Jun. 2024
13. Sonntag im Jahreskreis (B)
29. Jun. 2024
29. Juni: hl. Petrus und Paulus (Fest)
27. Jun. 2024
27. Juni: Fest der Mutter von der Immerw. Hilfe (Fest)
24. Jun. 2024
24. Juni: hl. Johannes des Täufers (Fest)
23. Jun. 2024
12. Sonntag im Jahreskreis (B)
20. Jun. 2024
20. Juni: Weltflüchtlingstag (Sonst.)
16. Jun. 2024
11. Sonntag im Jahreskreis (B)
09. Jun. 2024
10. Sonntag im Jahreskreis (B)
07. Jun. 2024
Heiligstes Herz Jesu (B)
02. Jun. 2024
9. Sonntag im Jahreskreis (B)
30. Mai. 2024
Fronleichnam (B)
26. Mai. 2024
Dreifaltigkeitssonntag (B)
20. Mai. 2024
Pfingstmontag - Maria, Mutter der Kirche (B)
19. Mai. 2024
Pfingstsonntag (A/B/C)
18. Mai. 2024
Pfingsten, am Vorabend (A/B/C)
12. Mai. 2024
7. Sonntag der Osterzeit (B)
09. Mai. 2024
Christi Himmelfahrt (B)
06. Mai. 2024
Bitttage (A/B/C)
05. Mai. 2024
6. Sonntag der Osterzeit (B)
01. Mai. 2024
1. Mai: Tag der Arbeit, hl. Josef (Fest)
30. Apr. 2024
1. Mai: Tag der Arbeit, hl. Josef (Fest)
28. Apr. 2024
5. Sonntag der Osterzeit (B)
21. Apr. 2024
4. Sonntag der Osterzeit (B)
14. Apr. 2024
3. Sonntag der Osterzeit (B)
08. Apr. 2024
25. März: Verkündigung des Herrn (Fest)
07. Apr. 2024
2. Sonntag der Osterzeit (B)
01. Apr. 2024
Ostermontag (A/B/C)
31. Mär. 2024
Ostersonntag (A/B/C)
30. Mär. 2024
Osternacht (B)
29. Mär. 2024
Karfreitag (A/B/C)
28. Mär. 2024
Gründonnerstag (A/B/C)
24. Mär. 2024
Palmsonntag (B)
19. Mär. 2024
19. März: hl. Josef (Fest)
17. Mär. 2024
5. Fastensonntag (B)
10. Mär. 2024
4. Fastensonntag (B)
03. Mär. 2024
3. Fastensonntag (B)
25. Feb. 2024
2. Fastensonntag (B)
18. Feb. 2024
1. Fastensonntag (B)
14. Feb. 2024
Aschermittwoch (A/B/C)
11. Feb. 2024
6. Sonntag im Jahreskreis (B)
04. Feb. 2024
5. Sonntag im Jahreskreis (B)
02. Feb. 2024
2. Februar: Darstellung des Herrn (Fest)
28. Jan. 2024
4. Sonntag im Jahreskreis (B)
21. Jan. 2024
3. Sonntag im Jahreskreis (B)
14. Jan. 2024
2. Sonntag im Jahreskreis (B)
07. Jan. 2024
Taufe des Herrn (B)
06. Jan. 2024
Erscheinung des Herrn, Dreikönig (A/B/C)
01. Jan. 2024
Neujahr - Fest der Gottesmutter Maria (A/B/C)
31. Dez. 2023
31. Dezember: Jahresschluss (Sonst.)
31. Dez. 2023
Fest der hl. Familie (B)
26. Dez. 2023
26. Dezember: hl. Stephanus (Fest)
25. Dez. 2023
Weihnachten, am Tag (A/B/C)
25. Dez. 2023
Weihnachten, am Morgen (A/B/C)
24. Dez. 2023
Weihnachten, in der Nacht (A/B/C)
24. Dez. 2023
Weihnachten, am Vorabend (A/B/C)
24. Dez. 2023
4. Adventsonntag (B)
17. Dez. 2023
3. Adventsonntag (B)
10. Dez. 2023
2. Adventsonntag (B)
08. Dez. 2023
8. Dezember: Mariä Empfängnis (Fest)
03. Dez. 2023
1. Adventsonntag (B)
26. Nov. 2023
Christkönigsonntag (A)
19. Nov. 2023
33. Sonntag im Jahreskreis (A)
12. Nov. 2023
32. Sonntag im Jahreskreis (A)
09. Nov. 2023
9. November: Weihe der Lateranbasilika (Fest)
05. Nov. 2023
31. Sonntag im Jahreskreis (A)
02. Nov. 2023
2. November: Allerseelen (A/B/C)
01. Nov. 2023
1. November: Allerheiligen (A/B/C)
29. Okt. 2023
30. Sonntag im Jahreskreis (A)
22. Okt. 2023
29. Sonntag im Jahreskreis (A)
15. Okt. 2023
28. Sonntag im Jahreskreis (A)
08. Okt. 2023
27. Sonntag im Jahreskreis (A)
07. Okt. 2023
Erntedank (Sonst.)
01. Okt. 2023
26. Sonntag im Jahreskreis (A)
24. Sep. 2023
25. Sonntag im Jahreskreis (A)
17. Sep. 2023
24. Sonntag im Jahreskreis (A)
14. Sep. 2023
14. September: Kreuzerhöhung (Fest)
10. Sep. 2023
23. Sonntag im Jahreskreis (A)
03. Sep. 2023
22. Sonntag im Jahreskreis (A)
27. Aug. 2023
21. Sonntag im Jahreskreis (A)
20. Aug. 2023
20. Sonntag im Jahreskreis (A)
15. Aug. 2023
15. August: Mariä Himmelfahrt (Fest)
13. Aug. 2023
19. Sonntag im Jahreskreis (A)
06. Aug. 2023
6. August: Verklärung des Herrn (Fest)
30. Jul. 2023
17. Sonntag im Jahreskreis (A)
23. Jul. 2023
16. Sonntag im Jahreskreis (A)
16. Jul. 2023
3. Sonntag im Juli: Heiligster Erlöser (Fest)
16. Jul. 2023
15. Sonntag im Jahreskreis (A)
09. Jul. 2023
14. Sonntag im Jahreskreis (A)
02. Jul. 2023
13. Sonntag im Jahreskreis (A)
29. Jun. 2023
29. Juni: hl. Petrus und Paulus (Fest)
27. Jun. 2023
27. Juni: Fest der Mutter von der Immerw. Hilfe (Fest)
25. Jun. 2023
12. Sonntag im Jahreskreis (A)
24. Jun. 2023
24. Juni: hl. Johannes des Täufers (Fest)
18. Jun. 2023
11. Sonntag im Jahreskreis (A)
16. Jun. 2023
Heiligstes Herz Jesu (A)
11. Jun. 2023
10. Sonntag im Jahreskreis (A)
08. Jun. 2023
Fronleichnam (A)
04. Jun. 2023
Dreifaltigkeitssonntag (A)
29. Mai. 2023
Pfingstmontag - Maria, Mutter der Kirche (C)
28. Mai. 2023
Pfingstsonntag (A/B/C)
27. Mai. 2023
Pfingsten, am Vorabend (A/B/C)
21. Mai. 2023
7. Sonntag der Osterzeit (A)
18. Mai. 2023
Christi Himmelfahrt (A)
14. Mai. 2023
6. Sonntag der Osterzeit (A)
07. Mai. 2023
5. Sonntag der Osterzeit (A)
30. Apr. 2023
4. Sonntag der Osterzeit (A)
23. Apr. 2023
3. Sonntag der Osterzeit (A)
16. Apr. 2023
2. Sonntag der Osterzeit (A)
Einführungen zu den Gottesdienstlesungen - Ltg 0
1. Lesung - Apg 2,42-47
Lesung aus der Apostelgeschichte.
Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest
und an der Gemeinschaft,
am Brechen des Brotes und an den Gebeten.
Alle wurden von Furcht ergriffen;
und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen.
Und alle, die glaubten,
waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam.
Sie verkauften Hab und Gut
und teilten davon allen zu,
jedem so viel, wie er nötig hatte.
Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel,
brachen in ihren Häusern das Brot
und hielten miteinander Mahl
in Freude und Lauterkeit des Herzens.
Sie lobten Gott
und fanden Gunst beim ganzen Volk.
Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu,
die gerettet werden sollten.
In der ersten Lesung werden Szenen und Situationen geschildert, die einen idealtypischen Charakter besitzen und wichtige Elemente des Lebens in der Gemeinde darstellen:
- Festhalten an der Lehre der Apostel
- Einmütigkeit untereinander
- soziale Verantwortung
- Gemeinschaft in Eucharistie und Gebet
Dreh- und Angelpunkt des Handelns der Gemeinde war der Tempel, "in dem sie Tag für Tag einmütig verharrten".
In diesem kurzen Text zeigen sich auch die Grundpfeiler christlichen Lebens: Martyria (Verkündigung und das Bekenntnis der Frohbotschaft - Zeugnis geben), Liturgia (Gedächtnis von Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi), Diakonia (Dienst am Notleidenden, am Nächsten - soziale Verantwortung) und Koinonia (Gemeinschaft).
In der Schriftstelle aus der Apostelgeschichte werden idealtypische Elemente christlich-gemeindlichen Lebens in wenigen Strichen herausgearbeitet:
das Festhalten an der Lehre der Zeugen des Auferstandenen, also der Apostel, die Einmütigkeit untereinander und die soziale Verantwortung sowie die Gemeinschaft in Eucharistie und Gebet.
Nicht zu übersehen ist, dass der Tempel der Mittelpunkt dieser christlichen Urgemeinde von Jerusalem war. Tag für Tag war man dort. Das entsprach dem Wurzelboden der Urgemeinde wie auch der Jesusbewegung überhaupt.
Die knappen Angaben über die ersten Christen von Jerusalem erweisen einen großen Beziehungsreichtum: Das Leben des einzelnen vollzieht sich in der Beziehung zu Gott (Gebet) und zu den Mitmenschen (Einmütigkeit, soziale Verantwortung). Auch die Christengemeinde als ganze weiß sich in doppelter Beziehung: Sie lebt aus der Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn (Eucharistie) und übt einen guten Einfluß auf sie umgebende andersgläubige Menschengruppen aus. Gottesdienst und Weltverantwortung sind kennzeichnend für die Christengemeinde.
Bei der vorliegenden Textstelle aus der Apostelgeschichte handelt es sich um einen Sammelbericht, wie sie in der Apostelgeschichte noch einige vorkommen. Es geht dabei nicht um eine historische Schilderung, sondern will Lukas vielmehr idealtypisch Elemente christlichen Lebens an der Urgemeinde herausarbeiten.
Richtig verstandenes Beibehalten alter Traditionen, Einmütigkeit (nicht 100% Übereinstimmung in allen Belangen) und soziale Verantwortung, Gemeinschaft der Eucharistie und Gebet sind damals wie heute Grundpfeiler christlichen Gemeindelebens. Wenn Lukas hier das Wort "verharren" verwendet, so bedeutet das auch: Ausharren in Geduld, ständige Bereitschaft zum Neubeginn, auch das Durchhalten so mancher ernüchternder Situationen, die oft gar nichts mehr mit dem Enthusiasmus der ersten Zeit zu tun hat.
Die wenigen Angaben über das Gemeindeleben spiegeln einen großen Beziehungsreichtum: Das Leben des einzelnen Christen vollzieht sich in der Beziehung zu Gott (Gebet) und zu den Mitmenschen (Einmütigkeit, soziale Verantwortung).
Auch die Christengemeinde als ganze weiß sich in doppelter Beziehung: Sie lebt aus der Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn (Eucharistie) und übt einen guten Einfluß auf sie umgebende andersgläubige Menschengruppen aus (beachte auch den Gedanken der Kontrastgesellschaft im Werk der beiden Lohfinks). Gottesdienst und Weltverantwortung sind kennzeichnend für die Christengemeinde.
Antwortpsalm - Ps 118,2. 4. 14-15. 22-24. 28
Kv - Danket dem Herrn, denn er ist gut,
denn seine Huld währt ewig. – Kv
(Oder: Halleluja, oder GL 444)
So soll Israel sagen: *
Denn seine Huld währt ewig.
So sollen sagen, die den Herrn fürchten: *
Denn seine Huld währt ewig. – (Kv)
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr; *
er ist für mich zur Rettung geworden.
Schall von Jubel und Rettung in den Zelten der Gerechten: *
„Die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie!“ – (Kv)
Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, *
er ist zum Eckstein geworden.
Vom Herrn her ist dies gewirkt, *
ein Wunder in unseren Augen. – (Kv)
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; *
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen.
Mein Gott bist du, dir will ich danken. *
Mein Gott bist du, dich will ich erheben. – Kv
2. Lesung - 1 Petr 1,3-9
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus.
Gepriesen sei
der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus:
Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt
zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten,
zu einem unzerstörbaren,
makellosen und unvergänglichen Erbe,
das im Himmel für euch aufbewahrt ist.
Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben,
damit ihr die Rettung erlangt,
die am Ende der Zeit offenbart werden soll.
Deshalb seid ihr voll Freude,
wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss,
dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet.
Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben,
die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde
und doch vergänglich ist,
herausstellen –
zu Lob, Herrlichkeit und Ehre
bei der Offenbarung Jesu Christi.
Ihn habt ihr nicht gesehen
und dennoch liebt ihr ihn;
ihr seht ihn auch jetzt nicht;
aber ihr glaubt an ihn und jubelt
in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude,
da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet:
eure Rettung.
Bernhard Zahrl (2011)
Martin Leitgöb (2005)
Alfons Jestl (2002)
Der erste Petrusbrief wendet sich an Gemeinden in Kleinasien, die in der Diaspora (Zerstreuung) leben, und möchte die Gemeindemitglieder in Zeiten der Verfolgung in ihrem Glauben und in ihrer Nachfolge des Evangeliums stärken. Der Verfasser stellt sich selbst in die apostolische Tradition und Autorität des Petrus. Um das Ziel der Glaubensstärkung erreichen zu können, verweist er auf zwei Glaubenserfahrungen der Christen: "Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten" sind sie aufgrund des Erbarmens Gottes in der Taufe "wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung". Den Christen ist dadurch ein unzerstörbares Erbe unwiderruflich zuteil geworden, das jetzt noch nicht vollkommen offenbar ist.
In der jetzigen Situation sind die Christen noch vielen Versuchungen und Auseinandersetzungen ausgeliefert. Zu diesen Prüfungen, in denen sich der Glaube "wertvoller als Gold erweist", tritt eine "unaussprechbare und von himmlischer Herrlichkeit verklärte Freude", die im Vertrauen und Wissen um das Ziel des Glaubens gründet.
Der erste Petrusbrief dürfte laut Exegeten - um 95/96 n. Chr. gewissermaßen unter Autoritätsanleihe des Apostels Petrus verfasst worden sein. Er richtet sich als Mahn- und Trostschreiben an verfolgte Gemeinden in Kleinasien.
Der Beginn der Schriftstelle ist durch Anklänge auf die urkirchliche Taufliturgie geprägt, die aber als solche nicht mehr faßbar ist.
Ein wichtiger Begriff im weiteren Verlauf der Schriftstelle heißt "Freude". Sie ist das schlechthinnige Kennzeichen christlichen Lebens. Die Freude, die aus dem Glauben an die Auferstehung kommt, gibt Hoffnung wider aller Hoffnungs - und Trostlosigkeit. Sie kann Kraft im Leben schenken gegen alle Widrigkeit des Leidens und der Verfolgung.
In der Antike war es üblich einen Brief mit einem Dank an die Gottheit zu beginnen. In dieser Übersetzung steht "gepriesen". Dies ist reine Übersetzungsangelegenheit. Weiter geht es mit Wiedergeburt, bzw. hier als "neu geboren" formuliert. In griechischen Kulten war dies üblicher Gedankengang: Der alte Mensch stirbt, ein neuer wird geboren.
Hier hakt der Schreiber des Briefes ein, zugleich geht es aber in folgende Stoßrichtung: Wer an Jesus Christus glaubt, für den beginnt eine neue Lebenswirklichkeit.
Not und Elend bleiben nicht erspart. Gott macht den Glaubenden nicht zu einer Marionettenfigur, welche er vor jeglicher Verletzung schützt, und doch birgt er in seiner schützender Hand.
Prüfungen sind somit nicht Willkürakte durch Gott, sondern die Glaubenden bewegen sich eben in dieser Welt mit all ihren Problemen, Schwierigkeiten, Not und Elend. Nicht als Verdrängung oder Vertröstung dient das Heil, welches in der Zukunft liegt. In der Formulierung "...das Ziel...erreichen werden..." spannt sich verbindender Bogen zwischen dem Leben hier und der Himmlischen Herrlichkeit.
Ruf vor dem Evangelium - Joh 20,29
Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!
Halleluja.
Evangelium - Joh 20,19-31
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Am Abend dieses ersten Tages der Woche,
als die Jünger aus Furcht vor den Juden
bei verschlossenen Türen beisammen waren,
kam Jesus,
trat in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten
zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.
Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch.
Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an
und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
Denen ihr die Sünden erlasst,
denen sind sie erlassen;
denen ihr sie behaltet,
sind sie behalten.
Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf,
war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
Die anderen Jünger sagten zu ihm:
Wir haben den Herrn gesehen.
Er entgegnete ihnen:
Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe
und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel
und meine Hand nicht in seine Seite lege,
glaube ich nicht.
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt
und Thomas war dabei.
Da kam Jesus bei verschlossenen Türen,
trat in ihre Mitte
und sagte: Friede sei mit euch!
Dann sagte er zu Thomas:
Streck deinen Finger hierher aus
und sieh meine Hände!
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
Thomas antwortete und sagte zu ihm:
Mein Herr und mein Gott!
Jesus sagte zu ihm:
Weil du mich gesehen hast, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Noch viele andere Zeichen
hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan,
die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind.
Diese aber sind aufgeschrieben,
damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist,
der Sohn Gottes,
und damit ihr durch den Glauben
Leben habt in seinem Namen.
Bernhard Zahrl (2011)
Martin Stewen (2004)
Wolfgang Jungmayr (2001)
Der Evangelientext gliedert sich formal in drei Teile:
a) Verse 19-23: Jesu Erscheinung vor den Jüngern und Sendung des Heiligen Geistes
b) Verse 24-29: Bericht über die Erscheinung vor den Jüngern, eigentliche "Thomas-Szene"
c) Verse 30-31: Abschluss
Den Mittelpunkt bildet die Aussage, dass der Gekreuzigte und der Auferstandenen ident sind und gleichsam Kontinuität in der Handlung besteht. Durch das Gottesbekenntnis "Mein Herr und mein Gott!" durch Thomas in Vers 28 wird diese Kontinuität bestätigt.
Diese Evangelienstelle und die vorangegangenen stellen den Anfang des Glaubens an den Auferstandenen, den Osterglauben dar - die Texte haben die Funktion, "damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.".
Der vorliegende Text kann in drei abgeschlossene Einheiten geteilt werden: die Begegnung Jesu mit den Jüngern, die Begegnung Jesu mit Thomas und die Schlusserklärung. Anders als sonst (Joh 18:20) finden die Ereignisse hinter verschlossenen Türen statt. Jesus tritt in die Mitte seiner Jünger und begrüßt sie mit dem jüdischen Friedensgruß -dieser wird nun zum Zeichen des Heiles und der Auferstehung. Nach einer Legitimationsgeste beauftragt und ermächtigt Jesus die Jünger (und Jüngerinnen?) zur Sündenvergebung. Wie das aber genau aussehen soll (Taufe etc.), bleibt unklar. Die Beauftragung findet sich versinnbildlicht in der Weitergabe des Lebensatems (vgl. Gen 2,7; Ex 37,9).
Die Thomas-Begegnung hat den Charakter einer Ermahnung an die nachösterlichen Gemeinden. Sie müssen sich anders als die Apostel damit begnügen, dass sie glauben sollen ohne zu sehen - in diesem Glauben aber sollen sie standhaft sein. Die Aussage, dass sich die Jüngerschar jeweils am ersten Tag der Woche (der Ausdruck “achter Tag” beinhaltet Ausgangs- und Endtag der Zählung) versammelte, ist ein Hinweis auf den Herrentag, zu dem die Gemeinde zusammenkommt, das Mahl feiert und an Jesu Gegenwart in den Gestalten von Brot und Wein glaubt, ohne ihn leiblich zu sehen. Die Bedeutung der Thomas-Geschichte im Auferstehungsgeschehen selbst ist zweitrangig. Das zeigt sich an dem Umstand, dass - anders als bei der ersten Begegnung Jesu mit der Jüngerschar - recht ungenau formuliert wird. So bleibt etwa die Frage, warum Thomas nicht bei der Schar ist, ungeklärt. Auch wird nicht beschrieben, ob Thomas Jesus berührt hat. Die Abschlusserklärung (Vv. 30f) unterstreicht die Ermahnung.
Es ist eine paradoxe Situation, die Johannes beschreibt: Die Jünger wissen durch Maria Magdalena bereits, dass Jesus lebt, dieses Wissen bleibt aber ohne Folgen. Sie tun nichts, denn ohne Jesus sind sie noch unfähig, etwas zu tun. Sie fühlen sich alleingelassen und sind voll Furcht hinter verschlossenen Türen. Da erscheint plötzlich Jesus, mitten unter den Jüngern macht er sich sichtbar. Er entbietet ihnen seinen Frieden, als Zeichen, dass er die gottfeindliche Welt besiegt hat, und er zeigt sich ihnen als der verherrlichte Gekreuzigte. Nun können sich die Jünger auch darüber freuen, dass Jesus zum Vater zurückgegangen ist.
Der zweite Friedensgruß soll die Jünger befähigen, sich der Welt als Gesandte Jesu zuzuwenden. Von nun an wird der Heilige Geist, der von Gott und von Jesus stammt, in den Jüngern weiterwirken.
Thomas kann dem Wort der Übrigen nicht trauen. Das Kommen Jesu acht Tage später gilt Thomas. Jesus tadelt zwar sein Begehren, weist es aber nicht zurück. Thomas spricht sein Bekenntnis, ohne sein Begehren, die Wunden zu berühren, auszuführen. Johannes schreibt diese Szene für die skeptischen Menschen. Im Zweifel des Thomas kommt auch ihr Zweifel zum Ausdruck. Sie sollen ebenfalls zum Bekenntnis für Jesus gelangen, auch wenn sie keine Chance mehr haben, ihren Zweifel durch die Möglichkeit einer eigenen Untersuchung ausräumen zu können.
Ich glaube an die Auferstehung
Gibt es objektive Wissenschaft?
Die Pandemie hat in vielen Menschen das Vertrauen in die Wissenschaft erschüttert: oder besser gesagt: zurechtgerückt. Denn lange Zeit haben viele keine weiteren Fragen mehr gestellt, wenn behauptet wurde: "Die Wissenschaft hat festgestellt…" oder "es ist wissenschaftlich erwiesen…". Die vielen Diskussionen rund um die Pandemie haben uns vor Augen geführt: Wissensfindung ist viel mühsamer, als sich das viele vorstellen, und geschieht meist in langen Diskussionen von Fachleuten. Es stellt sich die grundsätzliche Frage: Gibt es objektive Wissenschaft? Jeder ernstzunehmende Wissenschaftler bemüht sich zwar um Objektivität, ist aber nicht frei von "erkenntnisleitenden Interessen", die ihn und das Ergebnis seiner Arbeit bewusst und unbewusst beeinflussen.
Auch in der Theologie stellt sich die Frage: Was ist dran an unserem Glauben an die Auferstehung? Könnte es nicht sein, dass die menschliche Sehnsucht nach Ewigkeit uns dazu verführt, dass wir uns an jeden Strohhalm der Hoffnung klammern? Oft ist der Wunsch der Vater eines Gedankens. Ist Jesus wirklich auferstanden? Können wir uns auf die Berichte der Bibel verlassen? – Wissenschaftliche Theologie sucht darauf verlässliche Antworten zu finden.
Thomas, ein sympathischer Skeptiker
Im Evangelium haben wir heute vom Apostel Thomas gehört. Er gilt als Urtyp des Skeptikers. Wer ihn als "ungläubig" oder als Zweifler bezeichnet, tut ihm Unrecht. Er will sich nicht täuschen lassen. Er will nur glauben, was er mit eigenen Augen sehen und womöglich mit eigenen Händen greifen kann.
Wie leicht sich unsere Sinne täuschen lassen, ist uns im Umgang mit modernen Medien besonders bewusst geworden. Mittlerweile wissen wir, dass dies auf vielfache Weise ausgenützt wird und dass wir den Versprechungen der Werbung, aber auch den Darstellungen von Politikern und Journalisten nicht kritiklos vertrauen dürfen. Auch im religiösen Bereich sind Scharlatane unterwegs, die nicht an unserem Seelenheil interessiert sind.
Thomas möchte ganz objektiv sein. – Aber geht das in seinem Fall überhaupt? Er hat eine persönliche Geschichte mit Jesus. Er war sein Jünger, hat ihm vertraut, vielleicht sogar blind vertraut. Dieses Vertrauen ist total enttäuscht worden, als er mit eigenen Augen sehen musste, wie seine Hoffnungen in den Messias Jesus am Kreuz zerstört wurden. Ich kann gut verstehen, dass er den Erzählungen seiner Freunde nicht glauben kann. Er will sich nicht länger täuschen lassen.
Als ihm aber Jesus gegenübersteht, zeigte sich alles in einem ganz anderen Licht. Ein weiteres Mal ist alles ganz anders, als er geglaubt hat. - "Paradigmenwechsel" nennt man so etwas in der Wissenschaft. – Derselbe Jesus, mit dem ihn eine persönliche Lebens- und Glaubensgeschichte verbindet, steht ihm nun gegenüber. Er kann oder könnte ihn jetzt berühren, umarmen… In diesem Augenblick wird er von Jesus zuinnerst berührt und kann nur noch stammeln: "Mein Herr und mein Gott".
Warum ich glaube
Im wissenschaftlichen Sinn gibt es keine Beweise für die Auferstehung Jesu. Dennoch glaube ich an die Auferstehung und daran, dass auch ich in irgendeiner Weise einmal auferstehen werde. Mein Auferstehungsglaube baut auf das Zeugnis der Jüngerinnen und Jünger Jesu. Dabei zählen für mich nicht allein die Erzählungen, die von ihnen überliefert sind. Für mich zählen mindestens ebenso ihre Lebenszeugnisse. Wer lässt schon alles liegen und stehen und zieht in die Welt hinaus, um allen Menschen ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit Jesus bekannt zu machen? Viele von ihnen haben ihre Mission mit dem Leben bezahlt. Die wissenschaftliche Theologie hat dazu durch Jahrhunderte hindurch das ganze Wissen zusammengetragen, analysiert und diskutiert.
Am intensivsten habe ich mich den Fragen nach der Auferstehung jedoch nicht in den Hörsälen und Bibliotheken der Theologie gestellt. Unter die Haut gegangen ist mir diese Frage am Kranken- und Sterbebett mir nahestehender Menschen. Da war ich als Bruder, Freund, Sohn oder Seelsorger selbst ein persönlich Betroffener. "War es das nun?" "Ist das alles?", frage ich mich jedesmal. Jeder Tod konfrontiert mich auch mit meiner eigenen Sterblichkeit. Betroffen machen mich auch die Opfer von Kriegen, von Katastrophen, Unfällen, Hilfseinsätzen; sofern ich mich davon betreffen lasse. - Ich halte nur ein gewisses Maß an Betroffenheit aus.
Dem steht das Wunderbare meines eigenen Lebens gegenüber - nicht was ich daraus gemacht habe, sondern was mir geschenkt wurde - und all die Wunder, denen ich in der ganzen Schöpfung begegne.
In dieser Betroffenheit glaube ich der Verheißung, dass dem Gott und Schöpfer allen Lebens die Wunder nicht ausgehen, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat und dass er meinen Lieben und auch mir immerwährendes Leben schenken kann. Auch ich kann da nur stammeln "Mein Herr und mein Gott!"
Wie können wir eine österliche Kirche sein?
Kirche ist einfach
Die Kirche steht immer noch auf ihrem Platz, aber sie ist leer geworden. Nur vereinzelt dürfen Menschen sie betreten. Zu besichtigen gibt es nichts mehr.
Die Kirche sucht immer noch ihren Platz, aber er wird ihr von vielen schon lange streitig gemacht. Eine große Institution mit ehrwürdiger Vergangenheit ist auf Anfänge zurückgeworfen.
Die Kirche behauptet immer noch ihren Platz, aber die großen Worte verhallen. In den alten vertrauten Formen wohnt eine unstillbare Sehnsucht.
Dabei ist Kirche so einfach, so schlicht: Festhalten an der Lehre der Apostel, treue Gemeinschaft, Brechen des Brotes und das Gebet. Dann, so heißt es, geschehen sogar viele Wunder und Zeichen.
Lukas beschreibt hier das Urbild von Kirche – Wunder und Zeichen eingeschlossen, ungeachtet der vielen später hinzugekommenen Ausdrucksformen, Dogmen und Streitigkeiten. Klar, ich kann darüber diskutieren, was denn die Lehre der Apostel ist, ich kann einer Gemeinschaft Grenzen ziehen, ich kann mich über die Eucharistie entzweien und selbst im Gebet kann ich Menschen ausschließen. Das geschieht bis heute. Doch Lukas beschreibt in seiner Ur-Geschichte des Christentums, was - eigentlich - alle (!) sehen: Die Gläubigen halten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Besonders schön ist das Wort „Festhalten“. Eine Hand hält fest – eine Hand wird gehalten. Ich halte fest – ich werde gehalten. Wenn das nicht auch ein Wunder ist, was denn?
Mit Geist erfüllt
Eine kleine Beobachtung, aber nicht am Rande! Lukas beschreibt „Kirche“ als österliche, als pfingstliche Geschichte. Im Evangelium heißt es, dass Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger „anhaucht“ und mit Geist (er)füllt. Ostern beseelt! In der Apostelgeschichte wird diese Geschichte in bunten Farben erzählt. Der Auferstandene gießt seinen Geist aus! Wobei das Wort „gießt“ schon von einer Fülle ausgeht, die nicht tröpfchenweise auf uns kommen kann. Und weil das nicht reicht: es ist ein feuriges Geschehen. Wir werden entzündet. Ostern steckt an! Was daraus folgt? Einfach und schlicht: Menschen halten fest und werden gehalten, sie teilen das eine Brot und sind im Gebet alle verbunden. Das ist Gottes Geist, der Geist der Liebe, lebendig, vielseitig, umfassend und ergreifend.
Ein Dämon geht um. Zuviel Leid ist in der Welt. Viele Menschen sind schon einen schrecklichen Tod gestorben, viele werden die Krise nicht überstehen. Andere Menschen haben riesige Ängste um ihren Lebensunterhalt, um ihre Familien. Sie bangen um ihre Existenz. Die, die Verantwortung tragen in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft müssen auf Hochseilen lavieren. Sie müssen Stärke und Elastizität demonstrieren – und wissen doch vieles auch nicht. Sicherheiten, die fest verankert und gut aufgestellt schienen für die Ewigkeit – Makulatur. Das weltweit. Die einen werden es besser verkraften, andere – in Flüchtlingslagern, in Entwicklungs- und Schwellenländern – noch einmal mehr an Grenzen geführt. Nein, Corona macht nicht alle gleich! Not macht einsam!
Unsere Kirchen sind geschlossen. Unsere Herzen nicht.
Wir freuen uns an der Lehre der Apostel, die uns die Welt Gottes aufschließt.
Wir danken für die Gemeinschaft, die uns auch in der Distanz trägt.
Wir schmecken das Brot, das auf der Zunge zergeht.
Wir verbinden uns im Gebet. Mit Gott und den Menschen.
Manchmal haben wir keine Worte. Manchmal schaffen wir es nur bis zur Klage. Manchmal wächst uns aber ein großes Vertrauen zu.
Halten und gehalten werden
Lukas stellt uns eine Kirche vor Augen, die etwas in der Hand hält – und die gehalten wird. Die etwas sagen, etwas zeigen kann – und doch nicht aus sich lebt.
Zu den schönsten Zügen dieser Kirche gehört, wie Menschen etwas von sich abgeben können, um es anderen zuzuwenden. Wie Menschen von sich wegschauen können, um andere in den Blick zu nehmen. Wie Menschen die Lehre der Apostel teilen, um dann Gemeinschaft zu feiern.
„Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt.
Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu,
die gerettet werden sollten.“
Wie können wir eine österliche Kirche sein?
Wir haben nur die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet.
Und, natürlich, die Aussicht, dass viele Wunder und Zeichen geschehen!
Die Kirche liebt ihren Platz, der groß ist und weit. Wie die Lehre der Apostel, wie die Gemeinschaft der Heiligen, wie das geteilte Brot, wie das die Welt umspannende Gebet.
"Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch"
Unerwartete Begegnung
Wer kennt das nicht: Man fühlt sich allein in einem Raum und plötzlich ist jemand da, mit dem oder mit der man nicht gerechnet hat? "Hast du mich jetzt erschreckt!" heißt es dann und man ist erleichtert, wenn der oder die Unerwartete eine vertraute Person ist. Der Schrecken muss wohl umso größer sein, wenn diese Person fremd ist oder man sich nicht vorstellen kann, wie sie hereingekommen ist.
So muss es wohl auch den Jüngern ergangen sein, als da plötzlich Jesus in ihrer Mitte war, obwohl sie sich aus Furcht vor Verfolgung eingeschlossen hatten. Erst recht konnte niemand damit rechnen, dass Jesus da war, nachdem ihnen all die Ereignisse um seinen Tod noch in den Knochen steckten.
Und es ist durchaus verständlich, dass einer, der das nicht miterlebt hat, alles nicht glauben kann. Da muss man gar kein großer Skeptiker sein, zu dem der Apostel Thomas gerne hochstilisiert wird.
Jesus war es aber offensichtlich ein Anliegen, dass alle auf dem gleichen Wissens- und Überzeugungsstand waren. Einerseits waren die Jünger ja seine Freunde, andererseits hatte er ein Anliegen, für das er alle brauchte und ins Boot holen wollte. Für ihn begann eine neue Ära, von der die Jünger noch nichts ahnten. Jesus will, dass seine Sache weitergeht. Für ihn ist seine Mission noch nicht zu Ende.
Die Sendung Jesu
Um dies zu verstehen, müssen wir zurück an den Anfang: Bei seiner Taufe im Jordan kam der Geist Gottes auf Jesus herab. Dieser ist von nun an die treibende Kraft, die ihn erfüllt. Der Geist führt ihn zunächst in die Wüste. Nach der Gefangennahme des Täufers treibt der Geist Jesus öffentlich aufzutreten und den Anbruch des Reiches Gottes als Evangelium zu verkünden, während die anderen Johannes-Jünger sich zurückzogen. Der Geist Gottes begleitet Jesus auf dem ganzen Weg bis zum von den Jüngern unerwarteten Ende in Jerusalem. Die Evangelisten Matthäus und Lukas wissen sogar zu berichten, dass bereits die Zeugung und die Geburt Jesu vom Heiligen Geist bewirkt waren.
Das Werk des Heiligen Geistes ist nicht mit dem Tod Jesu und auch nicht mit seiner Auferstehung zu Ende. Die Auferstehung Jesu ist mehr als ein Happy End einer dramatischen Geschichte. Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten müssen zusammen gesehen werden, um sie verstehen zu können.
Jesus tritt in die Mitte seiner noch verstörten Jünger und übergibt ihnen sein Werk mit den Worten: "Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch;" und: "Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert." Das große Werk der Versöhnung der Menschheit mit dem Vater, das Jesus begonnen hat, geht weiter in der Verantwortung der Jünger.
Unsere Mission der Barmherzigkeit
Das "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch", gilt auch uns, den Nachfolgern der Jünger Jesu. Den Auftrag "Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert", nur als Vollmacht der Sündenvergebung zu betrachten und den Papst und die Bischöfe dafür zuständig zu erklären, ist eine Engführung in der Auslegung dieses Sendungsauftrages Jesu.
Papst Johannes Paul II. hat den Weißen Sonntag zum Sonntag der Barmherzigkeit erklärt und damit das Thema Barmherzigkeit stärker in die Mitte der Theologie und der Pastoral gerückt. Das Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus ausgerufen hat, ist zwar zu Ende, bleibt aber Programm für die ganze Kirche.
Dabei geht es meines Erachtens nicht nur um die Frage, wie finde ich einen barmherzigen Gott angesichts meines persönlichen Versagens und wie kann das Sakrament der Versöhnung neu belebt werden. Vielmehr sollte unser ganzes Leben von Barmherzigkeit geprägt und getragen werden. Das gilt im Umgang mit den Menschen, die an uns schuldig geworden sind, dies gilt aber auch für den Umgang mit Menschen, die in unserem unbarmherzigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem zu Verlierern geworden sind. Dies betrifft die Schwächeren in unserer eigenen Gesellschaft. Dies betrifft aber auch all jene, die von den selbsternannten Herrschern aus ihren Heimatländern vertrieben worden sind. Nicht zuletzt ist unser ganzes Weltwirtschaftssystem davon betroffen, das einzelne sehr reich macht und viele arm bleiben lässt.
Die Jünger hatten sich zunächst "aus Furcht vor den Juden" eingeschlossen. Wir neigen aus diversen anderen Gründen dazu, uns abzukapseln und auf unser eigenes Wohl – leiblich wie seelisch – zu schauen. Jesus tritt auch an uns heran und fordert uns auf, sein Werk der Barmherzigkeit Gottes in die ganze Welt hineinzutragen.
Gesandt, die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden
Sonntag der Barmherzigkeit
Als die Jünger sich nach dem Verrat an Jesus und nach dessen Tod im Abendmahlsaal eingesperrt hatten, befanden sie sich wie in einem Loch. Das schlechte Gewissen, Jesus verleugnet zu haben, bedrängte sie. Hoffnungslosigkeit drückte sie nieder. Jesus war in ihren Augen tot. Dazu kam die Angst, die Juden könnten mit ihnen so verfahren wie mit Jesus. Da ergreift Jesus die Initiative. Er betritt am Osterabend den Raum - trotz verschlossener Türen - und spricht zu ihnen: “Friede sei mit Euch!” Er zeigt ihnen die Wundmale - er ist es wirklich, der Gekreuzigte. Die Jünger erkennen ihn - sie sehen die Wunden und müssen sich ihnen stellen. Auch jetzt keine Vorwürfe, sondern wieder: “Friede sei mit Euch!“ Keine Abrechnung oder Strafe. Jesus ermutigt, seine Gegenwart belebt. Er ist barmherzig, trägt nichts nach, er vergibt. Dann haucht er sie an. Dieses Anhauchen ist die Geste, mit der Gott in die Nase des Adam den Odem des Lebens eingehaucht hat. Nun erschafft Jesus die Jünger im Oster-Geiste neu. Er ermächtigt zu neuem Leben. Umkehr, Neuanfang beginnen beim auferstandenen Christus, der entgegengeht. Versöhnung ist der Lobpreis auf den barmherzigen Jesus, der uns vergibt.
Deshalb hat Johannes Paul II. im Jahr 2000 gleich nach dem Osterfest den Weißen Sonntag zum Sonntag der Barmherzigkeit erklärt. Er selbst starb im Jahre 2005 am Vorabend dieses Sonntags.
Seinen Ursprung hat dieser neue Titel in den Erscheinungen der heiligen Ordensschwester Faustyna Kowalska aus Krakau in Polen. Sie lebte von 1905 bis 1938, in einer Zeit mit dem ersten Weltkrieg, der Weltwirtschaftskrise und mit dem Europa bedrohenden Nationalsozialismus. In der Glaubensverkündigung herrschte eine gewisse Strenge vor. Nach Aussage von Schwester Faustina erschien ihr Jesus mehrere Male. In den Visionen erhielt sie den Auftrag, Künderin der Barmherzigkeit Gottes zu sein. Es wurde Ihr auch aufgetragen, ein Bild Jesu malen zu lassen, von dessen Herzen zwei Strahlen ausgehen. Das gemalte Bild trägt die Unterschrift: „Jesus, ich vertraue auf Dich“. Das sollten wir oft beten. Jesus habe ihr auch aufgegeben, sich für die Einführung des Sonntags der Barmherzigkeit als Fest der Göttlichen Barmherzigkeit am Sonntag nach Ostern einzusetzen. Durch Sr. Faustina verbreitete sich auch der Barmherzigkeitsrosenkranz.
Das ist der Hintergrund, warum die Kirche seit einigen Jahren heute nicht nur den Weißen Sonntag begeht, sondern auch den Barmherzigkeitssonntag. Johannes Paul II. wusste, dass unsere Welt der Barmherzigkeit bedarf. Papst Franziskus führte dies in dem Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit fort.
Eine "Mission der Barmherzigkeit"
Überraschenderweise gipfelt das Evangelium vom Osterabend, wo Thomas nicht da war, im vergebenden Friedensangebot und im Satz: "Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben.“ Die Versöhnung der Menschheit mit dem Vater, seine Barmherzigkeit, soll durch die Jünger zu allen Menschen gebracht werden: das ist der johanneische Akzent des Missionsbefehls. Der Geist der Barmherzigkeit soll das Angesicht der Erde erneuern. Dieses „Pastoralprogramm“ gilt es auch heute, 2000 Jahre später, einzulösen. Wenn wir diese "Mission der Barmherzigkeit" ernst nehmen und uns an ihr ausrichten, helfen wir vielen Mitmenschen, den österlichen Geist Jesu zu entdecken.
Der Geist der Barmherzigkeit und Thomas
Thomas versäumt diese erste Begegnung der Jünger mit dem Herrn. Er glaubt den Jüngern nicht, was sie vom Auferstandenen berichten. Er will Fakten sehen, die er begreifen kann. „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.“
Als ihm Jesus eine Woche später gegenübertritt, ist dieser Wunsch plötzlich zweitrangig. Er wird überwältigt von der Ausstrahlung, die von der Person des Auferstandenen ausgeht. Nun "sieht" er viel mehr, als er zu sehen verlangte, und bekennt: "Mein Herr und mein Gott!". Jesus sagte zu ihm: „Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“
Das sind wir. Wir sehen Jesu nicht, doch mit unseren Schwestern und Brüdern, die mit uns als Kirche Ostern feiern, glauben wir. Um tiefer in seine österliche Barmherzigkeit hineinzufinden, sind wir eingeladen, das kurze Gebet „Jesus, ich vertraue auf Dich“! zu sprechen und zu wiederholen.
Glauben, Wissen und Vertrauen
Fragen lohnt sich
Auf längeren Autofahrten bin ich schon öfter auf die Rundfunksendung "Kinderuni" gestoßen. Dazu wird jeweils eine kleine Runde von Kindern eingeladen, Experten zu einem bestimmten Thema Fragen stellen. Diese beantworten die Fragen in einer altersgemäßen Sprache. Spannend ist für mich immer, auf welche Fragen die wissbegierigen Kinderuniteilnehmer kommen.
Als ich so alt war wie diese Kinder, stellten nur die Lehrer Fragen, die ich richtig zu beantworten hatte. Erst im Gymnasium hatte ich auch Lehrer, die Fragen zuließen. Doch ich erinnere mich auch an die Befürchtung, dass meine Fragen als dumm abqualifiziert werden könnten. Sehr dankbar bin ich meinen Lehrern an der Universität, die uns ermutigten, Fragen zu stellen und auch theologische Lehrmeinungen zu hinterfragen und so der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Nicht alle meine Studienkollegen und vor allem nicht alle älteren Mitbrüder schätzten diesen Zugang zur Theologie. Einige hatten die Befürchtung, dass das Genau-wissen-wollen vom Glauben wegführen könnte.
Mittlerweile haben höchste kirchliche Autoritäten klargestellt, dass Glaube und Wissenschaft einander nicht ausschließen. Papst Benedikt XVI. hat immer wieder betont, dass sich unser Glauben kritischen Fragen der übrigen Wissenschaften stellen müsse. Er selbst hat kritische Fragen gestellt, selbst wenn es politisch nicht opportun war.
Thomas will es genau wissen
Im Evangelium begegnete uns heute der Apostel Thomas, der ganz zu Unrecht den Spitznamen "der Ungläubige" bekommen hat. Es ist schon bezeichnend, dass er nicht dabei war, als Jesus den Jüngern am Ostertag zum ersten Mal erschienen ist. Offenbar ist er auch sonst eigene Wege gegangen. Er ist skeptisch und weiß darum, wie schnell Menschen bereit sind, von etwas überzeugt zu sein, allein weil es "alle" sagen. Er will es genau wissen. Als Jesus ihm eine Woche später gegenübertritt und ihm anbietet, die Finger in seine Wunden zu legen und seine Hand in die offene Seitenwunde, geht er in die Knie und bekennt "mein Herr und mein Gott". Offen bleibt, ob er wirklich die Wunden berührt hat oder ob ihm nicht die Begegnung mit dem Auferstandenen genügt hat.
Glauben und Wissen
Für mich ist in dieser Erzählung das Verhältnis von Wissen und Glauben bildhaft dargestellt. Es ist gut, wenn Menschen, die glauben wollen, kritische und heikle Fragen stellen, und wenn Fachleute diesen Fragen sorgfältig nachgehen. Das Fragen und das Beantworten von Glaubensfragen allein führt aber noch nicht zum Glauben, denn es gibt verschiedene Weisen des Glaubens. Z.B. glaube ich etwas, solange ich es nicht besser weiß. Das ist aber kein Glaube im existentiellen Sinn. Im "mein Herr und mein Gott" steckt viel mehr drinnen: Es enthält das Bekenntnis zu einer Person, der er vertrauensvoll folgen will. Dieser persönliche Akt geht über ein Glauben als "für wahr halten" weit hinaus. Dies ist eine persönliche Entscheidung, an die ich durch kritisches Fragen und Suchen zwar herangeführt werden kann, das Glauben ist jedoch ein eigener Akt. Ein Glauben in diesem Sinn kann nicht bewiesen werden und entzieht sich der Logik der Wissenschaften.
Der Glaube des "für wahr Haltens" hingegen ist ein weites Feld, auf dem sich viele große und kleine Geister tummeln. Es ist spannend und lohnend, sich damit zu beschäftigen. Es gehört dazu jedoch neben Intelligenz auch eine gewisse Redlichkeit. Immer wieder melden sich Menschen zu Wort, die nicht nur "alles" wissen, sondern vor allem alles besser wissen. Mit ihnen ist schwer zu diskutieren. Rund um das Osterfest werden sie von Medien gerne eingeladen, ihre Thesen darzulegen, weil dies meist mehr Interesse weckt als eine redliche Diskussion.
"Selig, die nicht sehen und doch glauben"
Und wie können Menschen damit umgehen, denen das alles zu kompliziert und zu hoch ist? Sie können sich am Wort des Auferstandenen anhalten: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben". Sie lassen sich von der Glaubwürdigkeit des Jesus von Nazareth überzeugen. Sie halten sich an das, was dieser Mensch gelebt, gesagt und ausgestrahlt hat. Zwar müssen sie damit rechnen, dass sie von einigen Zeitgenossen dafür ein wenig belächelt werden. Wenn sie jedoch selbst ein redliches und glaubwürdiges Leben führen, dürfen sie sich der Hochachtung wirklich "Weiser und Kluger" sicher sein.
Leben, das den Tod überwindet
Was macht Ostern für uns aus?
Das Erwachen der Natur "Vom Eise befreit...", Frühlingsglockenblumen, Fünftageurlaub.
Kirchlich: Exsultet - Osterfrühstück - Segen Urbi et Orbi in einem Sprachenwirrwarr.
Ein neuer Umgang des "Bischofs von Rom" mit den Katholiken - Reformhoffnungen.
Wer spricht von einer glückseligen Schuld, neuem Leben aus Ruinen, wer ist Zeuge der Auferstehung? Was ist der eigentliche Bereich des Todes, wer ist grenzüberschreitend am Ufer des Lebens? Was sind die Zeichen und Wunder, die jetzt von einer besseren Welt etwas ahnen lassen?
Wir können nicht in seine Seitenwunde tasten, ein leeres Grab nachprüfen. Ist nicht nötig!
Wir erleben ihn nicht einmal wie Magdalena als den fremdartigen, unantastbaren Gärtner? Wir stellen verbittert fest, dass uns der Bischof keinen seelsorgernden Pfarrer mehr schickt. Die jüngere Generation überlässt den ganzen falschen Zauber dem Osterhasenwarenhaus.
Die Reichen werden maßlos reich und die Armen werden kaum merklich immerzu ärmer.
Angst und Verelendung überborden allerorten, greise Menschen warten sinnlos und dement aufs Sterben, Pfleger und Betreuer holen wir aus noch ärmeren Ländern für sie herbei.
Thomas, Judas, Petrus...
Thomas zweifelte - Judas hat verzweifelt - Petrus glaubt, jetzt müssten eigentlich alle wie er Juden werden. Eine Generation später meinen sie, sie müssen die Jesusgeschichte aufschreiben. Was er getan - und dass er, wenngleich schmählich hingerichtet am Schandpfahl, doch nicht gescheitert ist. Im Glaubensbekenntnis halten sie fest: er ist geboren aus einer Jungfrau, hat gelitten und ist hinab-gestiegen in die Vorhölle, dann aber war das Grab leer und er in den Himmel entschwebt. Dort sitzt er zur Rechten des Vaters. Er kommt am Ende der Zeiten als Weltenrichter! Was er getan hat und was er eigentlich wollte, findet weniger Erwähnung. Ja, sie hätten noch Vieles aufschreiben können.
Für Judas, den Verräter suchen sie einen Nachfolger. Welche Qualifikation braucht ein Apostel-nach-folger? Er muss die Auferstehung bezeugen können. Wie denn nur? Wenn so einer dann behauptet, er habe den Auferstandenen gesehen wie Paulus, dann kann schon auch sein, dass er in einer schlimmen Nachfolge des Judas steht, zumal wenn er auf Macht und Rechthaberei setzt und dies sich in seinem Kopf so festgesetzt hat, dass für Liebe zu den Menschen im Herzen kein Platz bleibt.
Wann ist einer ein Zeuge der Auferstehung?
Wenn er die Lasten anderer trägt und glaubhaft vorlebt, dass die Liebe stärker ist als Tod und Teufel und alle Übel dieser Welt. Wenn er eine jesuanische Antwort hat, wie mit Macht, Geld und Sex zurechtzukommen ist. Der seiner Zweifel enthobene Thomas ging nach Indien: zweifellos bekommen wir jetzt dafür indische Sakramentenspender.
Paulus war stolz, römischer Bürger zu sein. Da durfte ihm Petrus nicht nachstehen und wollte ebenfalls nach Rom, die Hauptstadt der Welt. In einem Roman heißt es, dass Christus nur bis Eboli gekommen sei. Möglich, dass sein hitzköpfiger, doch erstrangiger Apostel es nicht einmal so weit geschafft hat.
Haben sie's gehört und beachtet: die ersten Christen hatten alles gemeinsam, waren also Kommunisten, keine gottlosen natürlich. Ich frage mich manchmal: wieso wurden Juden und Kommunisten die Feindbilder der katholischen Kirche schlechthin? Manche Intellektuellen fragten vor 70 Jahren: wenn es einen Gott gibt, wie konnte er Auschwitz zulassen? Ich frage: wenn wir Jesus verstanden haben, wie konnten gute Christenmenschen dann Kreuzzüge predigen, Kräuterweiblein als Hexen verbrennen, Waffen segnen und Herrschaftspaläste als Residenzen bewohnen? Und wer hat sich je dafür als Sünder bekannt?
Leben, das den Tod überwindet
Wir haben von dem Leben, das die Todesmächte überwindet, wahrscheinlich viel zu wenig kapiert. Wie optimistisch heißt es aber dennoch im Petrusbrief: "Ihr habt ihn nicht gesehen - aber ihr seid erfüllt von unaussprechlicher, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, die Ziel allen Glaubens ist!" (1 Petr1,8f).
Wolfgang Dettenkofer, Unterkirchengemeinschaft Christkönig Rosenheim.
HWDKHA@t-online.de
Mit Thomas in guter Gesellschaft
Das heutige Evangelium berichtet vom sogenannten "ungläubigen Thomas". Über seine Person, bzw. über seine Lebensdaten wissen wir sehr wenig.
In allen vier Evangelien des Neuen Testaments wird sein Name genannt, und zwar genauer gesagt in den "Apostel-Listen", also der Zusammenstellung, bzw. Nennung der Namen aller Apostel. In den synoptischen Evangelien (Markus, Matthäus und Lukas) steht er neben dem Zöllner Matthäus. In der Apostelgeschichte ist sein Platz neben Philippus. Vor allem aber das vierte Evangelium, das Evangelium nach Johannes, bietet mehr Informationen über ihn.
Weg - Wahrheit - Leben
Auch im Bericht über das "Letzte Abendmahl" wird Thomas erwähnt. Im Wissen um seinen baldigen Tod spricht Jesus davon, dass er gehe, um für die Jünger einen Platz vorzubereiten und, dass diese wüssten, wohin er gehe. Auch hier fällt Thomas auf, indem er meint, dies nicht zu wissen: "Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen?". Die Metapher Jesu wird von ihm offensichtlich nicht verstanden und dies veranlasst Jesus zum berühmten Wort "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben."
Mit Jesus gehen - mit Jesus sterben
Ein weiteres Mal begegnet uns Thomas im Johannesevangelium als sich Jesus entschließt, nach Betanien zu gehen und Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Hier spricht Thomas zu den anderen Jüngern: "Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben".
Zum Glauben kommen
Der vielleicht wichtigste und bekannteste Abschnitt ist das heutige Sonntagsevangelium. In diesem Text wird geschildert, wie Thomas Zweifel an der Auferstehung des Herrn formuliert und gleichsam einen Beweis dafür fordert. Als er dann acht Tage später die Wundmale sieht, spricht er das Glaubensbekenntnis "Mein Herr und mein Gott!" und kommt zum Glauben an die Auferstehung Jesu Christi. Ob er allerdings, so wie wir es wahrscheinlich vermuten würden und es auch auf vielen historischen Gemälden sehen können, seine Finger wirklich in die Wundmale des Herrn gelegt hat, ist im Neuen Testament nicht überliefert - und angesichts seines Glaubensbekenntnisses letztlich auch nicht mehr nötig.
Denken wir an die Evangelienstellen der vergangenen Tage, so sehen wir, dass der Apostel Thomas mit seinen "Glaubensproblemen und -zweifeln" nicht alleine ist.
Maria von Magdala etwa entdeckt das leere Grab, deutet es aber rein natürlich: der Leichnam ist weggenommen worden. Auch bei Simon Petrus löst das leere Grab kein Glaubensbekenntnis aus und der andere Jünger "sah" und "glaubte" erst dann. Auch Maria vermeint zuerst im auferstandenen Jesus den Gärtner zu erkennen und erfasst noch nicht, was sich ereignet hat. Erst die Anrede durch Jesus öffnet ihre Augen und lässt uns erkennen, dass der Auferstehungsglaube ein Geschenk des Auferstandenen ist.
Als der Auferstandene am ersten Tag der Woche zu den Jüngern kommt, zeigt er ihnen - so wie später auch unserem Apostel Thomas - seine Wundmale. Im Anschluss an das heutige Evangelium schreibt der Evangelist: "Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese sind aber aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen."
In Gesellschaft mit uns
Wenn wir vom ungläubigen Apostel Thomas sprechen, so hat dies in der Tradition zumeist einen schlechten oder gar negativen Beigeschmack. Irgendwie kommt er bei uns "nicht gut weg". Und doch müssen wir sehen, dass es viele unterschiedliche Personen im Evangelium gibt, die nicht so einfach zum Glauben kommen können. Auch für sie ist der Weg dorthin nicht einfach und bedarf der "Gabe zum Glauben" durch den Auferstandenen selbst.
Ich denke, Thomas ist im Evangelium vielleicht nur einer unter vielen, der seinen ganz persönlichen Zugang zum Glauben an die Auferstehung sucht. Aber einer, in dem wir uns wiederfinden können. Wie oft hätten denn nicht auch wir gerne ein Zeichen, das uns für unseren Glauben Gewissheit geben könnte, es uns einfacher machen würde: in Momenten der Trauer, der Enttäuschung, des persönlichen Scheiterns... Und so sind wir doch in guter Gemeinschaft mit Thomas, denn es gibt Mut zu sehen, dass auch er in seinem Glauben wachsen musste und letztlich doch das Glaubensbekenntnis "Mein Herr und mein Gott!" sprechen durfte.
Auferstehung passiert, wenn sich eine Tür öffnet
Gestatten Sie, mein Name ist Thomas
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Thomas, Apostel des Jesus von Nazareth... Dass ich vor meiner Begegnung mit IHM Fischer war, wissen Sie vermutlich nicht, aber Sie kennen wahrscheinlich meinen Spitznamen: Didymos. Dabei ist das gar kein Spitzname, sondern nur die griechische Übersetzung meines aramäischen Vornamens. "Thomas" bedeutet "Zwilling".
Und noch etwas ist weitum bekannt: Dass ich der Zweifler bin. Und darum glauben Sie mich zu kennen, nicht wahr? Thomas, der Zweifler. Der, der nicht glauben wollte, was er nicht sah. Aber Sie irren sich. Gezweifelt haben die anderen. Ich war verzweifelt.
Darum war ich auch nicht dabei, als ER den anderen Aposteln erschienen ist. Ich hielt es nicht aus in ihrer Gegenwart. Sie verschanzten sich und spielten "geschlossene Gesellschaft". Mich trieb es hinaus vor die Stadt. Ich wollte allein sein.
Aber auch wenn ich nicht wie sie hinter verschlossenen Türen in Todesstarre verfiel, so igelte ich mich dennoch ein in Verschlossenheit. Ich wollte nichts mehr hören und sehen.
Als ich sie dann wieder traf, erzählten sie mir von einer Begegnung mit IHM. Ich konnte es nicht glauben. Aber ich hatte den Eindruck, sie wussten auch nicht, was sie mir da erzählten. Und so sprach ich eigentlich nur aus, was alle dachten. Keiner von uns hatte kapiert, was hier eigentlich vorgefallen war. Unsere Türen waren wieder zugefallen.
Ich bin mir sicher, ER kam nicht wegen mir nocheinmal. ER kam nocheinmal, weil die Türen immer noch verschlossen waren. Er wusste, wie immer, wie es um uns stand.
So wie der Stein auf seinem Grab für ihn kein Hindernis war, so öffnete er die Türen vor unseren Seelengrüften. "Friede sei mit euch", sprach er zu uns. Jesu Friede ist der Dietrich, der Türen öffnet.
Jesus meinte keinen politischen Frieden. Sein Friede ist ein vom Geist erfülltes, gehauchtes Schalom, das Heilung schenkt. Der Friede Jesu ist eine offene Tür zum Leben.
Auferstehung passiert, wenn sich eine Tür öffnet
Und so wurde auch für uns Auferstehung erfahrbar. Ich weiß jetzt: Auferstehung passiert nicht erst nach dem Tod des Menschen, sondern es ist täglich erfahrbar. Auferstehung passiert, wenn sich eine Tür zum Leben öffnet: Wenn jemand nach einer schweren Krankheit überraschend gesund wird, wenn man sich nach einem Streit versöhnt, wenn in einer ausweglosen Situation eine Lösung gefunden wird, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht...
Sich berühren lassen
Ich konnte anfangs nicht glauben, was ich nicht angreifen konnte, was ich nicht be-greifen konnte. Und als dann Jesus vor mir stand, begriff ich: Ich muss ihn gar nicht angreifen. Es genügt Jesus zu erfahren. Wichtig ist nicht, ihn zu berühren. Wichtig ist es, die Sehnsucht wach zu halten und sich berühren zu lassen.
Und darin habe ich Ihnen gar nicht so viel voraus. Gewiss, ich habe ihn dann tatsächlich gesehen, aber auch Sie dürfen darauf vertrauen, dass Jesus auch ihre Türen öffnet und sein heilendes Shalom über Sie haucht. Sie müssen sich nur ausrichten auf das Leben, das Jesus schenkt.
"Selig sind, die nicht sehen und doch glauben." Denn das Wesentliche ist ohnehin für die Augen unsichtbar.
Die eigentliche Mitte des Christentums
Was bringt uns Ostern?
In der Liturgie der Kar- und Ostertage steht das Schicksal Jesu, sein Kreuz und seine Auferstehung im Vordergrund. Aber was bedeuten diese Ereignisse für uns Menschen? Was bringt uns Ostern? Welche Konsequenzen ergeben sich für unser Schicksal?
Diese Frage ist verwandt mit der Frage, die Karl Rahner in seinem letzten großen Vortrag aufgeworfen hat. Es ist die Frage: Was ist die "eigentliche Mitte des christlichen Glaubens"?
Karl Rahner beklagt, dass diese zentrale Frage von den Theologen "faktisch oft oder fast immer vergessen wird". Dies trifft nicht nur für Theologen zu, sondern auch für viele Christen. Auch sie haben die "eigentliche Mitte des christlichen Glaubens" oft nicht in den Blick bekommen oder sie vergessen
Was ist nun auf dem Hintergrund der Ostererfahrung "die eigentliche Mitte des christlichen Glaubens"? Was bewirkt Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene für uns? Was sagt uns zu dieser Frage der 1. Petrusbrief? Welche Antwort gibt Karl Rahner in seiner letzten großen Rede anlässlich seines achtzigsten Geburtstages?
Was ist die eigentliche Mitte des Christentums?
Was sagt der 1. Petrusbrief in der heutigen Lesung? Die Aussagen sind gewichtig: Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten haben wir eine lebendige Hoffnung. Wir empfangen das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe. Wir erlangen das Heil. Es wird uns Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil.
Nach diesen Worten werden wir durch Jesus Christus reich beschenkt:
Durch eine neue Geburt, eine lebendige Hoffnung, ein unzerstörbares und unvergängliches Erbe, durch den Anteil an Gottes Ehre und Herrlichkeit.
All diese Begriffe haben mit Gott zu tun. Gott ist uns in besonderer Weise nahe. Er wirkt in uns, er verwandelt uns. Er gibt uns Anteil an der göttlichen Natur (2 Petr 1,4)
Bei all diesen Begriffen geht es auch um die Mitte des christlichen Glaubens. Worin besteht die Mitte des Christentums nach Karl Rahner? "Die eigentliche und einzige Mitte des Christentums und seiner Botschaft ist darum für mich die wirkliche Selbstmitteilung Gottes in seiner eigensten Wirklichkeit und Herrlichkeit an die Kreatur, ist das Bekenntnis zu der unwahrscheinlichsten Wahrheit, dass Gott selbst mit seiner unendlichen Wirklichkeit und Herrlichkeit, Heiligkeit, Freiheit und Liebe wirklich ohne Abstrich bei uns selbst in der Kreatürlichkeit unserer Existenz ankommen kann und alles andere, was das Christentum anbietet oder von uns fordert dem gegenüber nur Vorläufigkeit oder sekundäre Konsequenz ist". (K. Rahner, Von der Unbegreiflichkeit Gottes. Erfahrungen eines katholischen Theologen, 4. Aufl., Freiburg: Verlag Herder 2006, S. 36).
Eine neue Qualität der Beziehung zwischen Gott und Mensch
Die Mitte des Christentums ist nicht das Engagement für Liebe und Gerechtigkeit in der Welt, nicht ein "Humanismus, der Gott für den Menschen verbrauchen will". Diese Mitte des Christentums ist eine neue Qualität der Beziehung zwischen Gott und Mensch, die Rahner als "Selbstmitteilung Gottes" beschreibt, eine Beziehung, wo der Geber und die Gabe identisch sind. Gott teilt sich uns mit und ist in uns. Der dreifaltige Gott wohnt in uns und wir in ihm.
Das ewige Leben - die Anschauung Gottes- ist sozusagen die organische Entfaltung dessen, was in der Selbstmitteilung Gottes schon gegenwärtig ist.
So gesehen geht es in der Osterliturgie um die eigentliche und letzte Bestimmung - Berufung - des Menschen. Jesus Christus , der Gekreuzigte und Auferstandene räumt die Hindernisse aus, die dieser Berufung entgegenstehen, und öffnet die Tore, damit sie sich verwirklichen kann.
- Liedvorschläge1
Hans Hütter
Lieder:
GL 318: Christ ist erstanden von der Marter alle
GL 321: Surrexit Dominus vere. Alleluja (Taizé)
GL 322: Ihr Christen, singet hocherfreut (Str. 7-11)
GL 323: Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt
GL 324: Vom Tode heut erstanden ist
GL 326: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit
GL 329: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 331: Ist das der Leib, Herr Jesu Christ
GL 332: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja
GL 334: O Licht der wunderbaren Nacht
GL 336: Jesus lebt, mit ihm auch ich
GL 337: Freu dich erlöste Christenheit
GL 338: Jerusalem, du neue Stadt
GL 362: Jesus Christ, you are my life
GL 387: Gott ist gegenwärtig
GL 422: Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr
GL 497: Gottheit, tief verborgen (4. Str.)
GL 642: Zum Mahl des Lammes schreiten wir
GL Ö828/Ö829/Ö830/Ö832: Der Heiland ist erstanden
GL Ö836: Surrexit Christus hodie. Alleluja
GL Ö837: Halleluja! Lasst uns singen
GL Ö838: Christus ist erstanden! Halleluja! (Kanon)
Psalmen und Kehrverse:
GL 66,1: Das ist der Tag, den der Herr gemacht; lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. – Mit Ps 118 - VI.
GL 312,9: Halleluja – Mit Psalm 98 (GL 55,2) - VIII.
GL 333: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja – Mit Psalm 121 (GL 67,2) oder mit Psalm 118 (GL 66,2) VI.
GL Ö835: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt – Mit Psalm 147 (GL 645,6) oder mit Psalm 100 (GL 56,2) - V.
GL Ö838,2: Christus ist erstanden, Halleluja, Halleluja – Mit Psalm 113 (GL 62,2) - V.
- Einleitung4
Manfred Wussow (2020)
Heute ist der „weiße Sonntag“. Früher wurde an diesem Tag Erstkommunion gefeiert. Früher – wie sich das anhört! Aber in diesem Jahr ist alles anders. Wir sehen immer noch dunkle Wolken. Das „grau“ mag noch nicht „weiß“ werden. Vieles musste verschoben werden, vieles ist noch mit Angst besetzt. Doch nach Tagen mit Einschränkungen macht sich Hoffnung breit. Wie es jetzt wohl weitergeht? Wie sich Normalität anfühlt? Wie wir mit Corona weiter leben?
Klemens Nodewald (2015)
Ostern muss Wirkung haben, darum geht es Lukas in seinem Bericht in der Apostelgeschichte vom Leben der Urgemeinde. Von Jesu Geist beseelt gilt es, im sorgenden Füreinander und im friedvollen Miteinander zu leben. Wo dies geschieht, geht wie von selbst eine Kraft von uns aus, die vom Auferstandenen Zeugnis ablegt und jene Gemeinschaft aufbaut, die Jesus gelebt hat.
Bitten wir ihn:
Hans Hütter (2013)
Der Sonntag nach Ostern wird auch "Weißer Sonntag" genannt. In den ersten Jahrhunderten des Christentums trugen die in der Osternacht Getauften bis zum ersten Sonntag nach Ostern ein weißes Gewand als Zeichen dafür, dass sie in der Taufe Christus angezogen haben. Getaufte leben aus dem Geist Jesu, der sie nun beseelt und erfüllt.
Uns vom Geist Jesu prägen und formen zu lassen, ist uns das ganze Leben hindurch aufgegeben.
Am Beginn des Gottesdienstes treten wir vor den Herrn hin und huldigen wir ihm:
Hans Hütter (2008)
Der 1. Sonntag nach Ostern hat mehrere Gesichter. Zunächst markiert er das Ende der Osteroktav, sozusagen der Osterfestwoche. Bis zu diesem Tag trugen in der alten Zeit die Neugetauften das weiße Taufgewand. Von da her hat dieser Tag auch die Bezeichnung "Weißer Sonntag". Im Anschluss an diese Tradition werden in vielen Gemeinden Kinder zur Erstkommunion geführt.
Die Liturgie dieses 2. Ostersonntags ist bestimmt von der Erzählung der Erscheinung des Auferstandenen vor seinen Jüngern. Er stattet sie mit dem Heiligen Geist aus und trägt ihnen auf, die Sünden zu vergeben. Aus diesem Umstand wird die Bezeichnung "Sonntag der Barmherzigkeit" abgeleitet. Dies regt uns an, einmal ausdrücklich die Barmherzigkeit Gottes zu bedenken.
Schließlich ist dieser Sonntag auch der Sonntag des "ungläubigen Thomas". Die Erzählung von seiner Begegnung mit dem Herrn ist tief im Gedächtnis vieler Menschen verankert. Es tut uns gut, von einem zweifelnden Jünger zu hören, und es hilft uns, mit unserem eigenen Zweifeln besser zurecht zu kommen.
Mit Thomas treten wir im Kyrie vor den Herrn hin und bekennen wir, dass er unser Herr und Gott ist.
- Kyrie5
Beatrix Senft (2023)
Herr, Jesus Christus,
als Liebe des Vaters hast du dich in die Welt senden lassen.
Herr, erbarme dich.
Nach Leid und Tod hast du uns in deiner Auferstehung Hoffnung auf neues Leben geschenkt.
Christus, erbarme dich.
Du sendest auch uns, deine Botschaft der Liebe Gottes weiterzutragen.
Herr, erbarme dich.
Klemens Nodewald (2015)
Herr Jesus Christus,
du rufst uns, dein begonnenes Heilswerk weiterzuführen.
Herr, erbarme dich.
Deine Auferstehung stärkt unser Vertrauen in dich als den Erlöser und Heiland.
Christus, erbarme dich.
Unsere Bemühungen willst du mit deiner Gnade unterstützen und mittragen.
Herr, erbarme dich.
Dir, Herr, vertrauen wir uns neu an.
Öffne unsere Augen und unsere Herzen,
damit wir deinen Weg mit uns gehen:
dir zur Ehre, zum Wohl der Mitmenschen
und zu unserem eigenen Heil. – Amen.
Hans Hütter (2014)
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Hl. Geist eingehaucht.
Herr, erbarme dich.
Du hast gesagt: Selig, die nicht sehen und doch glauben.
Christus, erbarme dich.
Du hast deine Jünger ausgesandt, den Frieden zu bringen.
Herr, erbarme dich.
Bernhard Zahrl (2011)
Herr Jesus,
du bist mitten unter uns,
wenn zwei oder drei von uns in deinem Namen beisammen sind.
Herr, erbarme dich.
Du bist mitten unter uns,
wenn wir dein Wort hören.
Christus, erbarme dich.
Du bist mitten unter uns,
wenn wir mit Brot und Wein deiner gedenken.
Herr, erbarme dich.
Guter Gott, wir danken dir für deine Auferstehung und unseren Glauben daran.
Verzeihe uns angesichts unserer Bemühungen unsere großen und kleinen Fehler und lass uns teilhaben an deiner Gegenwart.
Hans Hütter (2008)
Herr Jesus Christus,
du bist als Auferstandener deinen Jüngern erschienen
und hast ihnen den Frieden gebracht.
Herr, erbarme dich.
Du hast ihnen die verklärten Wundmale deiner Hände und deiner Seite gezeigt.
Christus, erbarme dich.
Du hast ihnen deinen Geist eingegeben
und ihnen aufgetragen, die Sünden zu vergeben.
Herr, erbarme dich.
- Tagesgebet4
Messbuch - TG Ostern 2 So: gereinigt durch das Bad der Taufe
Barmherziger Gott,
durch die jährliche Osterfeier
erneuerst du den Glauben deines Volkes.
Laß uns immer tiefer erkennen,
wie heilig das Bad der Taufe ist,
das uns gereinigt hat,
wie mächtig dein Geist,
aus dem wir wiedergeboren sind,
und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
MB 2. Sonntag der Osterzeit
Messbuch - TG Ostern 6 So: damit das Ostergeheimnis unser Leben verwandelt
Allmächtiger Gott,
laß uns die österliche Zeit
in herzlicher Freude begehen
und die Auferstehung unseres Herrn preisen,
damit das Ostergeheimnis,
das wir in diesen fünfzig Tagen feiern,
unser ganzes Leben prägt und verwandelt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
MB 6. Sonntag der Osterzeit
Messbuch - TG Auswahl 9: der Tod ist überwunden
Gott des Lebens.
Durch die Auferstehung deines Sohnes wissen wir :
Der Tod ist überwunden,
der Weg zu dir steht offen,
unser Leben ist unvergänglich.
Hilf uns,
in dieser Gewißheit unser Leben anzunehmen
und daraus zu machen, was du von uns erwartest.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
MB Auswahl 9
Messbuch - TG Auswahl 2: Lehre uns dich erkennen, dich verstehen, dich lieben
Gott.
Du hast uns geschaffen - doch wir kennen dich kaum.
Du liebst uns - und doch bist du uns fremd.
Offenbare dich deiner Gemeinde.
Zeige uns dein Gesicht.
Sag uns, wer du bist und was du für uns bedeutest.
Lehre uns dich erkennen, dich verstehen, dich lieben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
MB Auswahl 2
- Eröffnungsgebet3
Sonntagsbibel - Friede und Vergebung
Gott,
Friede und Vergebung
sind die großen Gaben des Auferstandenen an seine Jünger.
Schenke auch uns den Glauben,
daß der Herr mitten unter uns lebt und wirkt.
Durch Christus, unseren Herrn.
Beatrix Senft (2023)
Gepriesen seist du,
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.
In deinem Sohn hast du dich uns ganz offenbar gemacht
und uns in seiner Auferstehung die Hoffnung auf ewiges Leben geschenkt.
Wie seine Jüngerinnen und Jünger, stehen wir oft fassungslos und ungläubig da
und verschließen uns vor dieser Unfassbarkeit.
Öffne uns in diesem Gottesdienst neu
und mache uns bereit, dem Sendungsauftrag deines Sohnes zu folgen.
Manfred Wussow (2020)
Wir lechzen nach Wundern, Herr!
Und du schenkst uns Liebe!
Wir sehnen uns nach Sicherheit
und du führst uns durch Risiken.
Wir träumen von Normalität
und du lässt uns in Abgründe schauen.
Wir erbitten von dir, Herr,
den Mut, über Abhängigkeiten und Ängste zu reden,
das Vertrauen, neue Brücken zu bauen
und um die Freude, in der Kraft deiner Auferstehung
Wunder zu entdecken.
Du bist zum Anführer in das Leben geworden
in Jesus Christus,
der mit uns durch Dick und Dünn geht.
Deine Liebe ist von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
- Fürbitten10
Renate Witzani (2023)
Glaube ist eng verbunden mit einem Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und Gott. Wie jede andere Beziehung ist er ein Geschenk, auf das wir uns immer wieder neu einlassen müssen.
Bringen wir unsere Bitten vor Gott:
Für deine Kirche, dass wir uns gemeinsam von deinem Geist geleitet auf die überlieferte Lehre der Apostel besinnen und erkennen können, was an überkommenen Traditionen behalten und was abgelegt werden soll.
Für die vielen Menschen, die sich nach einem Leben in Frieden, Freiheit und Solidarität sehnen. Beten wir für alle, die weltweit von Krisen betroffen sind.
Für alle Kinder und Jugendliche, die dir in den kommenden Wochen im Empfang der Erstkommunion und Firmung tiefer begegnen werden.
Für alle, die sich in ihrem Blick auf eigenes oder fremdes Versagen von deiner Barmherzigkeit leiten lassen.
Für unsere Verstorbenen, die jetzt schon sehen, was wir im Glauben erhoffen.
Barmherziger Gott!
Dir gilt unser Dank und Lobpreis jetzt und allezeit. - Amen.
Manfred Wussow (2020)
Wir sind heute verbunden mit vielen Menschen, die ein Gebet sprechen.
Einsam, in einer Gruppe, in einem virtuellen Raum.
Wir rufen dich an, Gott, unser Vater, unsere Mutter.
Wir denken an die schwierigen Abwägungen, Beschränkungen zu lockern.
Hilf denen, die Zahlen analysieren und Entscheidungen treffen, kluge Wege zu öffnen.
Wir denken an die vielen ungeduldig wartenden Menschen.
Hilf ihnen, liebevoll und vorsichtig mit neuen Freiheiten umzugehen.
Wir denken an die bedrohten Menschen in Krisengebieten und Flüchtlingslagern.
Hilf uns, nicht nur die eigene angespannte Situation zu sehen,
sondern Solidarität zu üben.
Wir denken an die Menschen, die mit der Not Geschäfte machen.
Hilf uns, ihnen entgegenzutreten.
Wir denken an die einsamen und verlassenen Menschen.
Hilf ihnen, den Mut nicht zu verlieren.
Wir denken an die Menschen, die sterben müssen.
Nimm sie in deinen Arm.
Viele Gedanken kommen nicht zur Ruhe.
Gewohnt, über allen Dingen zu stehen, fürchten wir,
unter die Räder zu kommen.
Schenke uns den Mut der Apostel,
die Kraft der Gemeinschaft,
den Geschmack von Brot
und ein Herz voller Gebete.
Hans Hütter (2017)
Herr, Jesus Christus,
du hast deinen Jüngern deinen Geist eingehaucht
und sie ausgesandt, Gottes Barmherzigkeit zu verkünden.
Wir bitten dich für alle, die in unserer Gesellschaft auf Nachsicht und Barmherzigkeit angewiesen sind.
Lass sie Mitgefühl und konkrete Hilfe erfahren.
Wir bitten dich für alle Menschen, die unter Ungerechtigkeit und Verfolgung zu leiden haben.
Schenke ihnen Freiheit und Anteil am Wohlstand.
Wir bitten für alle Christen,
dass sie nicht müde werden, aus dem Geist der Barmherzigkeit die Welt mitzugestalten.
Wir bitte für alle Bischöfe und Priester, die beauftragt sind, den Menschen die Vergebung der Sünden zuzusprechen.
Gib ihnen Demut und Geduld.
Wir bitte für unsere Verstorbenen.
Zeige dich ihnen als barmherziger Erlöser.
Du, Herr, hast deinen Verfolgern vergeben.
Schenke auch uns die Kraft des Vergebens und Versöhnens.
Darum bitten wir dich, der du zum Vater heimgekehrt bist. – Amen.
Renate Witzani (2017)
Als Kirche Jesu Christi leben wir in der Schicksalsgemeinschaft mit ihm, unseren Herrn, und in enger Beziehung mit allen, die ihm nachfolgen.
In Solidarität mit allen unseren Schwestern und Brüdern lasst uns beten:
Für Papst Franziskus, der sich trotz der hohen Gefahrensituation aufgemacht hat, unseren koptischen Mitchristen in Ägypten Trost und Hoffnung zu geben.
Für alle, die weltweit Friedensprojekte unterstützen, und sich so der drohenden Eskalation weiterer bewaffneter Konflikte entgegenstellen.
Für alle, die sich im ehrlichen Blick auf ihr eigenes Ungenügen Gottes Barmherzigkeit und Erbarmen öffnen.
Für alle Kinder, die sich in diesen Tagen auf ihre Erstkommunion vorbereiten, dass sie beim gemeinsamen Mahl auch kirchliche Gemeinschaft erleben können.
Für unsere Verstorbenen, die an Christus geglaubt und in ihm ihr Heil gefunden haben.
Oft fühlen wir uns verwundet und verschreckt wie die Jünger nach Ostern.
Stärke uns in der Hoffnung auf dein Erbarmen, damit wir dich, so aufgerichtet, mit dem österliche Halleluja feiern und preisen. - Amen.
Klemens Nodewald (2015)
Herr Jesus Christus,
deinen Geist, den Hl. Geist, haben wir bei der Taufe empfangen.
Er will jeden in seinen persönlichen Anlagen stärken
und uns dazu verhelfen, Vielfalt und Gemeinschaft zu einer Einheit zu verbinden.
So erbitten wir füreinander offene Augen, wohlwollende Herzen,
das Streben nach Lebendigkeit im Glauben.
Christus, höre uns...
Erfülle Herr, mit Klugheit, Umsicht und Kraft alle,
denen in besonderer Weise Leitung anvertraut wurde:
im Staat, in der Gesellschaft, in deiner Kirche.
Christus, höre uns...
Schenke deine besondere Nähe
allen Suchenden und Ringenden,
Verfolgten und Misshandelten,
älteren und kranken Menschen.
Christus, höre uns...
Gewähre denen, die du zu besonderem Dienst in deiner Kirche berufst,
ein tiefes Vertrauen in dich und deinen Beistand,
damit sie deinem Anruf folgen.
Christus, höre uns...
Nimm die Verstorbenen auf in die Gemeinschaft mit dir.
Christus, höre uns...
Herr Jesus Christus,
auf den Wegen, die wir gehen, will der hl. Geist unser Begleiter sein.
Wir danken dir für seinen Beistand und sein Wirken in uns und unter uns.
Er wird uns zeigen, wie sich Vielfalt und Eins-sein zu einer Einheit verbinden lassen.
Preis und Dank sei dir zu aller Zeit. – Amen.
Renate Witzani (2015)
Im Heiligen Geist, der uns Kraft zum Leben schenkt,
lasst uns miteinander und für einander beten:
Für alle Neugetauften,
dass sie Kirche als lebendige Gemeinschaft erleben,
in der in Offenheit und gegenseitigem Wohlwollen Reich Gottes verwirklicht wird.
Für alle verfolgten Christen,
dass sie im Glauben an den auferstandenen Herrn für ihre persönlichen Nöte die Hoffnung auf Hilfe nicht verlieren.
Für alle jene, die sich in ihren Zweifeln nicht ernst genommen fühlen.
Für alle, die erkennen müssen, dass im Leben nicht alles machbar ist,
sondern in Geduld und Gottvertrauen die Lösung mancher Probleme erwartet werden muss.
Für unsere Verstorbenen,
dass sie durch Gottes Barmherzigkeit Anteil am ewigen Leben erhalten.
Denn der Heilige Geist ist über uns ausgegossen.
In ihm und durch Jesus Christus, den auferstandenen Herrn,
loben wir dich, den Vater, jetzt und in Ewigkeit. - Amen.
Hans Hütter (2014)
Guter Gott,
in Jesus von Nazareth bist du den Menschen nahe gekommen
und begreiflich geworden.
So wagen wir, dir unsere Bitten vorzutragen:
Wir bitten für alle Lehrer und Schüler der Theologie,
dass sie sich nicht scheuen,
die wesentlichen und für die Menschen wichtigen Fragen zu stellen.
Wir beten für alle Christen,
die kritische Geister ausgrenzen und aus ihrer Umgebung verbannen,
um den Mut, sich deren Fragen zu stellen.
Wir beten für alle Christen, die Angst haben,
die Freiheit der Kinder Gottes zu leben und zuzulassen,
um Vertrauen auf das Wirken deines Heiligen Geistes.
Wir beten für die Familien
und für alle Menschen, die Kinder erziehen,
dass es ihnen gelingt, sie zum Glauben zu führen.
Gott und Vater, du hast uns das Leben geschenkt.
Lass uns wachsen im Glauben, im Vertrauen und in der Liebe. - Amen.
Hans Hütter (2014)
Gott und Vater,
in der Auferweckung Jesu von Nazareth hast du gezeigt,
dass du Herr über Leben und Tod bist.
Wir bitten dich:
Für alle, die sich ängstlich zurückziehen und abschirmen.
Schenke ihnen Vertrauen und Mut, den Menschen zu begegnen.
Für alle, die nur den Kräften ihres Verstandes trauen.
Lass sie mit dem Herzen die Großartigkeit deiner Liebe erfassen.
Für alle, die ihren Mitmenschen nicht verzeihen können.
Lass sie über ihren Schatten springen und wahren Frieden erfahren.
Für alle, die das Ende ihres Lebens vor Augen haben.
Lass sie vertrauensvoll dir entgegen gehen.
Für alle unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde
Schenke ihnen Frieden und ewiges Leben.
Herr, wir vertrauen, dass du uns aus Liebe geschaffen hast
und dass deine Liebe kein Ende kennt. - Amen.
Bernhard Zahrl (2011)
Wir beten zu Gott unserem Herrn,
der seinen Jüngern erschienen ist
und die den Glauben an ihn fanden.
Jeder von uns kennt den Spruch "wer's glaubt wird selig".
Zeige uns, dass gerade der Glaube an dich große Kraft hat
und uns auch durch die Zeiten des Zweifels durchtragen kann.
Jeder von uns kennt Menschen, die hart und unbeweglich geworden sind -
vielleicht zählen auch wir dazu:
schenke ihnen und uns die Gabe, andere Meinungen anhören zu können
und zur kritischen Selbstreflexion,
damit sie und wir nicht in Einsamkeit verharren.
Jeder von uns kennt Situationen, in denen es ihm schwer fällt, zu glauben
und einen Sinn im Glauben an dich zu erkennen:
in Krankheit, Einsamkeit oder Leid wissen wir oft keine Antworten.
Gib uns die Kraft, diese Zeiten anzunehmen.
Jeder von uns ist oft mit "Blindheit" geschlagen und vermag dich nicht zu erkennen.
Guter Gott nimm weg unsere Gefühle von Scham und Schuld,
die uns Deine Gegenwart verdunkeln.
Wir bitten dich für die vielen Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden.
Hilf ihnen zu ihrem Glauben zu stehen und befreie sie von Verfolgung und Leid.
Wir bitten dich für alle Gläubigen,
die von der Kirche und auch von uns verletzt und gedemütigt worden sind.
Lass sie trotz all der Wunden, die sie erlitten haben,
weiter fest im Glauben stehen und schenke ihnen neuen Mut,
sich auch weiterhin in die Kirche einzubringen.
Wir bitten dich für unsere Verstorben,
die uns im Glauben an dich in die Ewigkeit vorausgegangen sind.
Lass sie dich sehen in deiner Herrlichkeit
und lass sie leben, geborgen in deiner Gegenwart.
Guter Gott, deinen Sohn hast du auferweckt,
um der Welt neues Leben zu schenken.
Dafür danken wir dir und preisen dich,
jetzt und in Ewigkeit.
Christoph Enzinger (2008)
Jesus Christus,
du öffnest unsere Türen und kommst zu uns.
Dich bitten wir:
Öffne die Tür der Resignation!
Schenke denen, die sich engagieren, Gewissheit,
dass ihr Tun etwas bewirkt.
Öffne die Tür der Trauer!
Erfülle die Trauernden mit neuer Hoffnung.
Öffne die Tür des Zweifels!
Schenke den Suchenden den Glauben an dich.
Öffne die Tür der Verzweiflung!
Bringe denen, die keinen Ausweg sehen, neuen Lebensmut.
Öffne die Tür des Misstrauens!
Zeige den Streitenden Wege zu Frieden und Versöhnung.
Öffne die Tür der Lethargie!
Sende den Antriebslosen den Heiligen Geist.
Öffne die Tür des Todes!
Schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben.
Jesus, unser Friede,
durch deine Auferstehung verwandelst du uns.
Wir danken dir und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
- Gabengebet3
Messbuch - GG Auswahl 9: lege deinen Geist in unser Herz
Vater im Himmel,
lege deinen Geist in unser Herz,
damit er uns belebe und heilige
und zu einer wahren Opfergabe mache für dich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
MB Auswahl 9
Messbuch - GG Ostern 2 So: durch den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt
Gott,
du hast deinem Volk
durch das Bekenntnis des Glaubens
und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt.
Nimm die Gaben (der Neugetauften und aller)
deiner Gläubigen gnädig an
und laß uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
MB 2. Sonntag der Osterzeit
Messbuch - GG Pfingsten Vorabend: dein Geist segne diese Gaben
Herr, unser Gott,
dein Geist segne diese Gaben
und erfülle durch sie die Kirche mit der Kraft deiner Liebe,
damit die ganze Welt erkennt,
dass du sie zum Heil gerufen hast.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
MB - Pfingsten, am Vorabend
- Lobpreis1
Hans Hütter (2020)
Kehrvers:
"Gott, du bist herrlich und heilig,
wir wollen dir lobsingen. Halleluja."
(GL 488,2)
Großer und erhabener Gott.
Wir treten vor dich, um dir zu danken für alles Großartige,
das du an uns getan hast.
Wir danken dir für alles Lebendige in der Schöpfung
und dafür, dass wir am Leben teilhaben dürfen.
Kehrvers
Wir danken Dir für Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist
und den Tod für immer überwunden hat.
Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige.
Er war tot und lebt nun in alle Ewigkeit.
Kehrvers
Wir danken dir, dass du ihn zu deiner Rechten erhöht
und ihm die Herrschaft über die ganze Welt übergeben hast.
Er lässt uns teilhaben an dem neuen Leben, das du ihm gegeben hast.
Kehrvers
Wir danken dir, dass er uns ganz nahe ist,
dass er unsere Zweifel und Ängste kennt und versteht
und uns entgegenkommt, wenn uns deine Wege unbegreiflich sind.
Kehrvers
Wir danken dir für den Heiligen Geist, den er uns eingehaucht hat,
Er gibt uns die Kraft, einender die Schuld zu erlassen, die Sünden zu vergeben
und einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat.
Kehrvers
Für all das danken wir dir.
In Freude stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und singen mit allen Engeln und Heiligen:
Danklied, z. B. GL 328: Gelobt sei Gott im höchsten Thron
- Präfation2
Messbuch - Präfation Osterzeit 2: Das neue Leben in Christus
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes
zum ewigen Leben,
durch ihn wird den Gläubigen
das Tor des himmlischen Reiches geöffnet.
Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden,
in seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden.
Durch ihn preisen wir dich (in österlicher Freude)
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB Osterzeit 2
Messbuch - Präfation Sonntage 6: Der Heilige Geist als Angeld der ewigen Osterfreude
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben.
Denn in dir leben wir,
in dir bewegen wir uns und sind wir.
Jeden Tag erfahren wir aufs neue
das Wirken deiner Güte.
Schon in diesem Leben
besitzen wir den Heiligen Geist,
das Unterpfand ewiger Herrlichkeit.
Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten
und uns die sichere Hoffnung gegeben,
daß sich an uns das österliche Geheimnis vollendet.
Darum preisen wir dich
mit allen Chören der Engel und
singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
MB Sonntage 6
- Mahlspruch1
Bibel
Empfanget des Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben.
(Joh 20,23)
Oder:
Selig, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja.
(Joh 20,29)
Oder:
Fürchte dich nicht!
Ich bin der Erste und der Letzte
und der Lebendige.
(Offb 1,17 b)
Oder:
Thomas antwortete Jesus:
Mein Herr und mein Gott!
(Joh 20,28)
- Meditation1
Helene Renner (2020)
Es wachse in euch der Mut,
euch einzulassen auf dieses Leben
mit allen seinen Widersprüchen
und mit all seiner Unvollkommenheit,
dass ihr beides vermögt:
kämpfen und geschehen lassen,
ausharren und aufbrechen,
nehmen und entbehren.
Es wachse in euch der Mut,
euch selbst liebevoll wahrzunehmen,
euch einzulassen auf andere Menschen
und sie teilhaben zu lassen
an dem, was ihr seid und habt.
Ostersegen erfülle euch
und mit euch die Menschen,
die zu euch gehören,
dass sich euch
inmitten dieser unbegreiflichen Welt
der Reichtum des Lebens zeigt.
- Schlussgebet4
Messbuch - SG Ostern 2 So: Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken
Allmächtiger Gott,
im heiligen Sakrament haben wir
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Laß diese österliche Gabe in uns weiterwirken
und fruchtbar sein.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
MB 2. Sonntag der Osterzeit
Messbuch - SG Ostern 6 So: neu geschaffen für das ewige Leben
Allmächtiger Gott,
du hast uns durch die Auferstehung Christi
neu geschaffen für das ewige Leben.
Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise,
damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
MB 6. Sonntag der Osterzeit
Messbuch - SG 9. Sonntag: Führe uns durch deinen Geist
Herr,
wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Führe uns durch deinen Geist,
damit wir uns nicht nur mit Worten zu dir bekennen,
sondern dich auch durch unser Tun bezeugen
und den ewigen Lohn erhalten in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
MB 9. Sonntag im Jahreskreis
Messbuch - SG Fastenzeit 4 So: Heile die Blindheit unseres Herzens
Allmächtiger Gott,
dein ewiges Wort ist das wahre Licht,
das jeden Menschen erleuchtet.
Heile die Blindheit unseres Herzens,
damit wir erkennen, was vor dir recht ist,
und dich aufrichtig lieben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
MB 4. Fastensonntag
- Gebet zum Abschluss1
Beatrix Senft (2023)
Gott,
als großes Geschenk hat sich Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngerinnen und Jüngern immer wieder geoffenbart.
Sein »Der Friede sei mit euch«, galt nicht nur ihnen, sondern gilt auch uns.
Und auch die Sendung »Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch«.
Ungläubig, wie Thomas, wollen wir Beweise für sein Da-Sein,
wollen ihn fass-bar, ja, an-fass-bar, haben,
damit wir diesen Worten trauen können.
Stärke du unseren Glauben und unser Vertrauen daran,
dass Jesus auch heute noch unter uns und durch uns wirken will
und segne unseren Weg durch die Zeit.
Das erbitten wir mit IHM,
Jesus Christus, unseren Buder und Herrn. – Amen.
- Segen2
Bernhard Zahrl (2011)
Wir bitten dich:
wenn wir jetzt nach Hause gehen,
lass uns weitertragen, was wir empfangen haben -
zu Freunden und zu Feinden,
zu Jungen und Alten
zu Kranken und Gesunden,
zu Zweiflern und Glaubenden.
Dazu segne uns Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Zitat (2008)
Gott mache die Tore deiner Seele weit
und öffne die Türen zu deinem Herzen,
dass die heilenden Kräfte dich durchströmen
und sich in dir ausbreiten können.
Gott breite in dir die Zweige der Hoffnung aus,
dass der Friede in dich einziehen kann
und deine Seele zur Ruhe kommt.
(Christa Spilling-Nöker)
Wenn Wissenschaft in Zweifel gezogen wird
Menschen in Österreich haben im EU-Vergleich wenig Interesse an Wissenschaft und Technologie. Und auffallend viele zweifeln Forschungsergebnisse an, über die wissenschaftlicher Konsens besteht. Zu diesem Befund kommt die jüngste Eurobarometer-Umfrage. Was hinter der Wissenschaftsskepsis steckt und wie man sie zurückdrängen könnte, darüber sprechen drei Wissenschaftler/innen der ÖAW.
Ganzer Beitrag:
https://www.oeaw.ac.at/news/wenn-wissenschaft-in-zweifel-gezogen-wird
ÖAW, Österreichische Akademie der Wisenschaften, 13.12.2021.
https://www.feinschwarz.net/zweifeln-um-zu-glauben/
Glauben und zweifeln gehören zusammen – wird gesagt. Aber ist es wirklich so einfach? Wie müssen wir vom Zweifeln sprechen und wo hat er im Glauben seinen Platz? Klärungen von Veronika Hoffmann.
Muss man zweifeln, um zu glauben? Ja, natürlich, sagen die einen, alles andere wäre ja naiv. Leute, die sich allzu sicher sind, was sie glauben, sind mindestens unsympathisch, möglicherweise sogar intolerant. Nein, sagen die anderen, auf die ganz fundamentalen Dinge meines Lebens muss ich mich verlassen können. Diese modische Attitüde „Ich-bin-ein-kritischer-Zeitgenosse-der-immer-eine-Frage-mehr-hat“ geht mir auf die Nerven. Damit kann man sich auch davor drücken, sich wirklich auf etwas einzulassen…
Dass die Frage überhaupt gestellt wird und dass viele sie positiv beantworten, ist im Blick auf den christlichen Glauben ziemlich neu. Lange Zeit galt weithin als ausgemacht, dass Glaube idealerweise gewiss sei. Zweifel stellte hingegen ein erhebliches Problem dar, unter Umständen war er sogar Sünde.
Ist es also höchste Zeit, den Zweifel endlich aus der Schmuddelecke herauszuholen und seine positive Bedeutung für den Glauben zu würdigen? Nicht wenige würden das heute enthusiastisch bejahen, und mit guten Gründen. Die Zeiten, in denen Zweifelnde moralisch diskreditiert wurden, sollten jedenfalls vorbei sein. Aber es lohnt sich vielleicht, nicht bei einer pauschalen Antwort zu bleiben, sondern noch etwas genauer hinzuschauen. Denn man kann mit „Zweifel“ durchaus Verschiedenes meinen.
Ganzer Beitrag:
https://www.feinschwarz.net/zweifeln-um-zu-glauben/
Feinschwarz, Theologisches Feuilleton, 12. April 2019
Was tun gegen Wissenschaftsskepsis?
Die Österreicherinnen und Österreicher stehen der Wissenschaft sehr skeptisch gegenüber. Um das Vertrauen nachhaltig zu steigern, muss laut der Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt bei der Bildung aufgeholt und die Kommunikation rund um wissenschaftliche Themen verbessert werden.
Ganzer Beitrag:
https://science.orf.at/stories/3214193/
Science ORF.at, 13.12.2021.
Seht – ich bin da
in die Verschlossenheit
aller Zeiten
eintretend
sich immer wieder
berührbar machen
entblößen
zeigen
sich preisgeben
preisgeben
alle Verletztheit
alle Wunden
Frieden damit machen
ja
Frieden zusprechen
in Berührbarkeit
zum Glauben einladen
auch
die Ungläubigen
die Zweifler
zur Vergebung einladen
die Kraft der Überwindung
einhauchen
und senden
immer
und
immer wieder
sich zeigen
sich verschenken
in vielen Zeichen
in vielen Formen
bis heute
spürbar
be-greif-bar machend
ICH BIN DA
mitten unter euch
Beatrix Senft 2023.
Thomas
Ich bin Thomas,
der zweifelt,
der nicht glauben kann,
der nur auf Tatsachen baut,
nicht auf andere hört …
Der die Zweifel erst vergessen kann
im Hinübergehen
ins andere Leben – abgeholt von IHM. –
„Mein Herr und mein Gott!“
Ilse Pauls
Wenn dies alles vorüber ist,
Wenn dies alles vorüber ist,
mögen wir nie wieder als selbstverständlich erachten:
Den Handschlag mit einem Fremden
Volle Regale im Supermarkt
Gespräche mit den Nachbarn
Ein überfülltes Theater
Freitag abends ausgehen
Den Geschmack des Abendmahls
Den Routine-Besuch beim Arzt
Das morgendliche Chaos, wenn die
Kinder zur Schule müssen
Kaffee mit einer Freundin
Die Gesänge im Stadion
Jeden tiefen Atemzug
Einen langweiligen Dienstag
Das Leben selbst.
Wenn dies alles endet,
mögen wir feststellen,
dass wir etwas mehr so geworden sind,
wie wir sein wollten,
wie wir sein sollten,
wie wir hoffen, sein zu können.
Und mögen wir auf diese Weise
besser zueinander sein,
weil wir das Schlimmste überstanden
haben.
Übersetzung: Daniel Müller Thor
Hoffen wider alle Hoffnung
Hoffen wider alle Hoffnung, glauben, dass es dennoch weitergeht.
Lieben, wo es beinah nicht mehr möglich,
damit die Welt auch morgen noch besteht
Fühlen, wo Gefühle sterben, Licht sehn da, wo alles dunkel scheint.
Handeln, anstatt tatenlos zu trauern,
trösten auch den, der ohne Tränen weint.
Wach sein, Zeichen klar erkennen, helfen trotz der eignen großen Not.
Aufstehen gegen Unrecht, Mord und Lüge,
nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht
Trauen dem, der uns gesagt hat: „Seht doch, ich bin bei euch alle Zeit.“
Mit uns ist er auch in unserem Suchen,
bis wir ihn schaun im Licht der Ewigkeit
https://www.youtube.com/watch?v=RdJnfrwvtJI
Heinz Martin Lonquich nach Mt. 28,20 in: Lieder zwischen Himmel und Erde, Münster 6. Aufl. 2011.
Religion und Religiosität
Man muss sich davor hüten, Religiosität mit Religion zu verwechseln – die lebendige innere Beziehung des Menschen zu einer tieferen Dimension des Lebens mit der organisierten äußeren Erscheinungsform dieser Beziehung. Das jedenfalls ist die Pointe einer der bis heute lesenswertesten Abhandlungen zum Thema Religion. Schon ihr Titel verrät ihren Charme: „Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern“. Ihr Autor heißt Friedrich Schleiermacher; ein protestantischer Pastor, aber ein untypischer, war er doch ein Liebhaber der griechischen Philosophie, die ihn zu seinen religionsphilosophischen Erwägungen inspirierte. Schleiermacher beginnt seine Reden damit, dass er den Zuständigkeitsbereich der Religionen radikal einschränkt. Weder sei es deren Sache, unverrückbare Wahrheiten über die Welt oder ewig gültige Dogmen zu formulieren; noch gehöre es zu ihren Aufgaben, moralische Regel und Gebote aufzustellen. Wahrheit zu ermitteln, sei vielmehr Gegenstand der Wissenschaft, ethische Richtlinien aufzustellen, Thema der Moralphilosophie. Wenn die Inquisition einst Wissenschaftler und Forscher der Ketzerei bezichtigte, weil sie den Mut hatten, die Wahrheitsansprüche der Kirche in Frage zu stellen, war das in Schleiermachers Augen ebenso ein Verrat an der Religion wie das Unterfangen der Kirchen, sich als moralische Autoritäten zu inszenieren, die meinen, das menschliche Leben maßregeln zu müssen. Mit Religion hat das nur von ferne zu tun, denn – so Schleiermacher – „ihr Wesen ist weder Denken, noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl“. Und er setzt noch eins drauf und sagt: „Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche.“
Sinn und Geschmack, Gefühl, ein Sich-ergreifen-Lassen vom Unendlichen. Das ist es, worum es bei aller Religiosität eigentlich geht. Es geht darum, mit einer Wirklichkeitsdimension in Beziehung zu kommen, die weiter und größer ist als der enge Horizont unserer persönlichen Identität. Es geht darum, sich einzulassen auf das Geschenk des Lebens mit all seinen Unwägbarkeiten – Ernst damit zu machen, dass wir nicht die Kontrolle haben; einzusehen, dass wir den Sinn unseres Lebens nicht selbst erzeugen können. All diese oft krampfhaften Bemühungen, kraft derer wir die Welt und das Leben nach unserem Bilde, nach unseren Wünschen und Vorstellungen formen wollen, verdampfen im Herzen, sobald es vom Sinn und Geschmack des Unendlichen erfüllt ist. Ob man „das Unendliche“ dabei „Gott“ oder „Allah“, „Geist“ oder „Himmel“ nennt, ist nebensächlich. Wichtig ist, sich ergreifen zu lassen von einer Dimension des Lebens, die sich unserer Verfügbarkeit entzieht, die wir nicht gemacht haben und von der wir doch auf gewisse Weise abhängen, weil wir von ihr unser Leben als Geschenk bekommen haben. Religiosität heißt, sich in Dankbarkeit und Liebe immer neu dieser Dimension zu öffnen und dabei jeder egoistischen Selbstbezogenheit und allen dogmatischen und ethischen Wahrheitsansprüchen Lebewohl zu sagen – um sich in das Gefühl des Unendlichen einzustimmen. Dafür kann man, muss man aber nicht in die Kirche gehen.
Aus: Christoph Quarch, „Der kleine Alltagsphilosoph“.
didymus
thomas und didymus
suchen und finden
hören und sehen
ablehnen und annehmen
fern sein und nah sein
nichts spüren und berührt sein
die Botschaft erfahren und Jesus erfahren
Christoph Enzinger, unveröffentlicht.
Zweifel – Feind des Glaubens
Der gefährlichste Feind des Glaubens und der Liebe ist der Zweifel: die bohrende Frage, ob nicht alles nur Betrug und Selbsttäuschung war. Gründe und Beweise helfen nicht weiter, sie werden ja ebenfalls in den Zweifel hineingezogen. Helfen kann nur eine große, alles verändernde Erfahrung: die Offenbarung der Wahrheit selbst oder die spontane Mitteilung der Liebe. Dem „ungläubigen“ Thomas hat Jesus seine Wunden gezeigt, um die Wunde des Zweifels zu heilen.
Aus: Schott-Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres B, Einführung zum 2. Sonntag der Osterzeit. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 1984.
Zwei Seelen...
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
die eine will sich von der andern trennen:
die eine hält in derber Liebeslust
sich an die Welt mit klammernden Organen;
die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
zu den Gefilden hoher Ahnen.
Die Botschaft hör wohl...
Chor der Engel:
Christ ist erstanden!
Selig der Liebende,
Der die betrübende,
Heilsam und übende
Prüfung bestanden.
Faust:
Was sucht ihr, mächtig und gelind,
Ihr Himmelstöne, mich am Staube?
Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind.
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust.
Vom Unsinn des ewigen Lebens
Ich bin von Berufs wegen - und, wie ich mutmaße, nicht nur von Berufs wegen - Philosoph, jedoch ganz und gar kein professioneller Theologe. Und auch der Umstand, dass ich mich seit vielen Jahren mit religiösen Themen beschäftige, wäre wohl kaum Legitimation genug, mich einem Thema zu widmen, welches die Hoffnung auf ein ewiges Leben ins Zentrum der Betrachtung rückt. Denn falls ich recht verstehe, entfaltet diese Hoffnung ihren guten Sinn nur innerhalb eines Glaubenskontextes, also - um mit Wittgenstein zu reden - eines „Sprachspiels“, welches nicht dasjenige der Philosophie ist. Zum religiösen Sprachspiel nämlich gehört eine Lebensform, die über die möglichen philosophischen Denkfiguren weit hinausgeht.
Wenn sich ein Philosoph, unbeschadet seines persönlichen Glaubens, trotzdem des Themas annimmt, dann meistens deshalb, weil man es auch negativ formulieren kann: Demnach ergibt, vom Standpunkt rationalen Denkens aus, der Begriff des ewigen Lebens, wie er sich dem Gläubigen als zentraler Hoffnungsmittler nahelegt, einfach keinen guten Sinn. Und meistens ist dann auch nicht von irgendeinem Glauben die Rede, sondern vom Glaubenstyp des Christen, der, heilsgeschichtlich bewegt, das persönliche Fortleben nach dem Tod zu den zentralen Grundsätzen seines Credos zählt. Wie könnte man sich so ein persönliches Fortleben vorstellen? Das ist die Frage des Philosophen, des Außenstehenden, und darüber hinaus die Frage des Gläubigen selbst, der schließlich nicht umhin kann, sich den Herausforderungen der - sagen wir - weltlichen Vernunft zu stellen.
Ich entsinne mich eines neueren Beispiels, zu dem sich schwerlich ein Besseres wird finden lassen: Terrence Malicks Filmepos The Tree of Life aus dem Jahre 2011. Dieser Film, dessen weibliche Hauptfigur, Mrs. O’Brian, nicht den Weg der Natur, sondern - wie es heißt - der Gnade wählte, endet mit einer Jenseitssequenz. In deren Verlauf begegnet der älteste Sohn der O’Brians in einer Strand- und Salzwüstenlandschaft seiner Familie und weiteren Menschen, die Teil seines Lebens waren oder auch nicht und sich als eine kleine Menschheit aufeinander zuzubewegen scheinen. Man mag diese Szene, die am Rand des Kitsches dahinschwebt, zur Not als eine Traumsequenz verstehen; näher liegt es freilich, sie als eine ambitionierte Verbilderungsbemühung der menschlichen Nachtodesexistenz aufzufassen, ist doch Malicks Film ein durch und durch religiös gestimmtes Opus.
Beim Betrachten der Szene konnte ich mich, Kitsch hin oder her, einer profunden Rührung nicht erwehren, und zwar gerade deshalb, weil die Bilder der sich aufeinander sanft und liebevoll Zubewegenden dem Zuschauer erst voll zu Bewusstsein bringen, dass eine derartige Wiederbegegnung mit den eigenen Lieben nach dem Tod undenkbar ist. Nicht nur können wir unseren Körper nicht mitnehmen, auch das, was wir unseren Geist nennen mögen, ja, unsere Seele, verliert mangels der Fähigkeit, den gehirnabhängigen Strom der Lebenserinnerungen zu konservieren, alle personale Identität. Als körperlose, außerräumliche, ihres Bewusstseins und Selbstbewusstseins verlustig gegangene Wesen hätten wir keinen Bezugspunkt mehr, um uns als die, die wir im Leben waren, selbsterkennend auf uns zu beziehen.
Falls wir indes postmortal als Teil der Weltseele oder des Weltgeistes weiterexistieren sollten, würden wir dies als entpersönlichte Wesen tun, die keinerlei Erinnerung mehr an ihre irdische Existenz und ihren Bestand in der Zeit hätten. Das Jenseits, einmal als Möglichkeit unterstellt, löscht Persönlichkeit und Individualität. Warum also auf ein personales Leben nach dem Tod hoffen, wo wir doch nicht einmal zu sagen imstande sind, wovon wir reden, wenn wir uns auf ein solches Leben beziehen? Nun, die Antwort, die uns an den Rand der Hoffnungslosigkeit und darüber hinaus zu bringen scheint, lautet: Wenn wir nicht einmal zu sagen imstande sind, worauf sich die Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod beziehen könnte, weil wir gar nicht wissen, wovon wir reden, wenn wir ein solches Leben ins Auge zu fassen versuchen - dann ist unsere ganze Existenz ohne Bedeutung inmitten eines bedeutungslosen Universums.
Es ist akkurat diese Antwort, die schon früh in der christlichen Lehrtradition davon hat reden lassen, dass wir, um nicht trostlos zu sich dabei um eine Manifestation des „Credo quia absurdum“ handelt. Man hat oft gesagt, dass eine solche Antwort aus der Innenperspektive des Glaubens, zumal in entsprechender konfessioneller Umrahmung und kraft ritueller Einbettung, darauf hinauslaufe, in den Gott der Liebe ein bedingungsloses Vertrauen zu setzen. Indem man sich in Gott absolut geborgen fühle, erübrige sich jede weitere Frage danach, wie es unter der Bedingung des Ablebens möglich sei, an ein ewiges Leben „danach“ - nach dem Exitus, nach dem Tod des Gehirns, nach dem Stillstand des Herzens, nach dem unumkehrbaren Ausfall aller Bewusstseinsfunktionen - zu glauben.
Geborgenheit in Gott bedeutet dieser Auffassung zufolge ewiges Leben. Von außen betrachtet freilich mutet die Haltung des Gläubigen als eine vollständige Kapitulation des Verstandes an. Frag nicht, glaube! Ist dies nicht der Imperativ, auf den alles hinausläuft, sobald es um Dinge geht, die entweder bloß fromme Märchen oder aber in ihrer Bedeutung opak, undurchdringlich, sind? Ich sagte soeben: „von außen betrachtet“, und hier wurzelt eine Grundschwierigkeit für jeden Gläubigen, namentlich auch für jeden durch die Schule der Aufklärung gegangenen Christenmenschen, der seine Hoffnung zugleich an ein persönliches Fortleben nach dem Tod bindet. Denn indem der Christ Mensch ist - eben Christenmensch -, kann er seiner Natur nicht entsagen. Er ist ein Homo Sapiens, ein denkendes Wesen, und als solches wird er nicht wahrhaft, nicht authentisch, ganz ohne doppelten Boden zu glauben imstande sein, sobald er die Wahrheiten, die ihm sein Verstand zwingend nahelegt, systematisch abdrängt und als Verstandeswesen kapituliert.
Peter Strasser in: Walter Kardinal Kasper / George Augustin (HG., Hoffnung auf das ewige Leben. Kraft zum Handeln heute. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2015
Intellektuelle Redlichkeit und geistige Entscheidung
Intellektuelle Redlichkeit ist nicht dort (oder nur dort) vorhanden, wo man der Last der geistigen Entscheidung ledig wird oder besser: ledig zu werden glaubt. Es besteht die große Versuchung zu meinen, derjenige sei der intellektuell Redliche, der der skeptisch Reservierte ist, der sich nicht engagiert, keine absolute Entscheidung trifft, zwar alles prüft, aber nichts behält (obzwar der Apostel anderes empfiehlt), dem Irrtum auszuweichen sucht, indem er sich auf nichts endgültig einläßt, die Schwäche der Unentschiedenheit - die als vorübergehend oder teilweise gegeben einzugestehen Pflicht sein kann - grundsätzlich zur Tapferkeit illusionsloser Skepsis umfälscht. Nein, so etwas ist nicht intellektuelle Redlichkeit. Gewiß, wer ehrlich meint, wahrhaft nicht mehr fertig zu bringen als ratlos z.B. ein bekümmerter Atheist zu sein, der verzweifelt nur das Medusenhaupt der Absurdität des Daseins vor sich sieht, der soll sich das ruhig eingestehen, der soll versuchen, auch diese Erfahrung gefaßt anzunehmen. Gott, so wird der Gläubige sagen, wird ihm auch das noch zum Segen werden lassen. Aber er soll nicht behaupten, daß das die einzig anständige Haltung intellektueller Redlichkeit sei. Woher wollte er das wissen? Woher weiß er, daß niemand aus diesem Purgatorio oder Inferno mehr herausgekommen sei? Woher weiß er, daß es nicht die Kraft gibt, dies alles zu erfahren und doch zu glauben?
Auf jeden Fall: Wir sind die zur Freiheit Verdammten oder mit ihr Gesegneten, wie man will (hier ist es noch gleichgültig, wie man die unausweichliche Freiheit interpretiert). Und diese Freiheit ist eine Freiheit, die auch die letzten geistigen Entscheidungen und Haltungen mitbestimmt. Es gibt keine letzten - gläubigen und ungläubigen - Grundhaltungen, keine Werttafeln und Koordinatensysteme des Daseins, die ohne die Anstrengung und das Wagnis der verantwortlichen Freiheit gegeben wären. Nicht weil hier blinde Willkür herrschte, sondern weil hier Einsicht und freie Tat nicht mehr getrennt werden können. So kommt es auch, daß derjenige, der sich skeptisch freihalten will, der sich nicht engagiert, der eine Einsicht nicht absolut ergreift, weil er das Wagnis zu irren angsthaft scheut, nicht frei bleibt, sondern das schlechteste Engagement eingeht. Denn er lebt, lebt einmal und setzt so Unwiderrufliches; er ist engagiert in der Tat seines Lebens. Versucht er dabei zu leben ohne Entscheidung, versucht er, sich gewissermaßen in der Dimension der "bruta facta" [nackten Tatsachen], des Biologischen zu halten, die Eintrittskarte in den Raum der Freiheit und Entscheidung zurückzugeben, "neutral" zu sein, dann ist das selbst nochmals eine Entscheidung, und niemandem wird klargemacht werden können, daß sie bessere Gründe für sich habe als eine andere.
Überdies gelingt es gar nicht, sich in einer Dimension zu halten, die vor der Entscheidung liegt. Der Versuch, neutral zu bleiben, ist also faktisch nur die Weigerung, zu den Entscheidungen reflex zu stehen, die im tathaften Vollzug des Lebens eben doch fallen, indem mindestens die Entscheidung darüber getan (wenn auch nur ansatzhaft reflex gedacht) wird, ob man das Leben als absurd oder von einem unsagbar geheimnisvollen Sinn erfüllt sieht.
Kurz: intellektuelle Redlichkeit gebietet den Mut zur geistigen Entscheidung, auch wenn diese belastet ist mit all der Unsicherheit, Dunkelheit und Gefahr, die nun einmal mit der geistigen Entscheidung eines endlichen, geschichtlich bedingten Geistes verbunden sind, der um diese seine Bedingtheiten weiß und doch entscheiden muß.
Aus: Karl Rahner Lesebuch, herausgegeben von Karl Kardinal Lehmann und Albert Raffelt. Herder Verlag, Freiburg Baasel Wien 1982.
Sokrates
Nach der Lektüre eines Buches über die Geschichte der Philosophie äußerte sich Herr K. abfällig über die Versuche der Philosophen, die Dinge als grundsätzlich unerkennbar hinzustellen. »Als die Sophisten vieles zu wissen behaupteten, ohne etwas studiert zu haben«, sagte er, »trat der Sophist Sokrates hervor mit der arroganten Behauptung, er wisse, daß er nichts wisse. Man hätte erwartet, daß er seinem Satz anfügen würde: denn auch ich habe nichts studiert. (Um etwas zu wissen, müssen wir studieren.) Aber er scheint nicht weitergesprochen zu haben, und vielleicht hätte auch der unermeßliche Beifall, der nach seinem ersten Satz losbrach und der zweitausend Jahre dauerte, jeden weiteren Satz verschluckt.«
Aus: Bertold Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 1965.
Glaube und Wissenschaft
Am Sonntag, dem 28. Januar 2007 kam Benedikt XVI. während einer kleinen Ansprache beim Angelusgebet auf dem Petersplatz auf den Tagesheiligen, den heiligen Thomas von Aquin und sein Werk zu sprechen. Der Papst sagte:
Der liturgische Kalender erinnert heute an den hl. Thomas von Aquin, den großen Kirchenlehrer. Mit seinem Charisma als Philosoph und Theologe bietet er ein anerkanntes Modell für die Harmonie zwischen Vernunft und Glauben, Dimensionen des menschlichen Geistes, die sich in der Begegnung und im wechselseitigen Dialog vollkommen verwirklichen. Gemäß dem Denken des hl. Thomas von Aquin »atmet« die Vernunft des Menschen sozusagen, das heißt sie bewegt sich in einem weiten, offenen Horizont, wo sie das beste von sich zum Ausdruck bringen kann. Wenn der Mensch sich dagegen darauf beschränkt, nur an materielle und im Experiment überprüfbare Objekte zu denken und sich den großen Fragen über das Leben, über sich selbst und Gott verschließt, verarmt er. Das Verhältnis von Glaube und Vernunft ist für die gegenwärtig in der westlichen Welt dominierende Kultur eine ernste Herausforderung...
Tatsächlich bringt die moderne Entwicklung der Wissenschaften unzählige positive Wirkungen hervor, wie wir alle sehen; sie sind immer anzuerkennen. Zugleich aber muß man zugeben, daß die Tendenz, nur das als wahr zu betrachten, was Gegenstand eines Experiments sein kann, eine Beschränkung der Vernunft des Menschen darstellt und eine schreckliche, mittlerweile klar erkennbare Schizophrenie hervorbringt, in der Rationalismus und Materialismus, Hypertechnologie und zügellose Triebhaftigkeit zusammenleben. Deshalb ist es dringend notwendig, in einer neuen Art und Weise die Vernünftigkeit des Menschen wiederzuentdecken, die offen ist für das Licht des göttlichen Logos und seine vollkommene Offenbarung: Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes. Wenn der christliche Glaube authentisch ist, demütigt er die Freiheit und die Vernunft des Menschen nicht; warum sollten also Glaube und Vernunft Angst voreinander haben, wenn sie sich am besten dann zum Ausdruck bringen können, wenn sie einander begegnen und miteinander in einen Dialog eintreten? Der Glaube setzt die Vernunft voraus und vervollkommnet sie, und die vom Glauben erleuchtete Vernunft findet die Kraft, sich zur Erkenntnis Gottes und der geistlichen Wirklichkeiten zu erheben. Die Vernunft des Menschen verliert nichts, wenn sie sich den Inhalten des Glaubens öffnet, vielmehr erfordern diese ihre freie und bewußte Zustimmung.
Nicht mutig
Die Mutigen wissen
Dass sie nicht auferstehen
Dass kein Fleisch um sie wächst
Am jüngsten Morgen
Dass sie nichts mehr erinnern
Niemandem wieder begegnen
Dass nichts ihrer wartet
Keine Seligkeit
Keine Folter
Ich
Bin nicht mutig
Marie Luise Kaschnitz, Kein Zauberspruch. Gedichte, Insel 1972.
Staunen vor den Wundern der göttlichen Schöpfung
Demnächst werde der Zeitpunkt erreicht sein, da alle Naturgesetze entdeckt sind und nichts für die Wissenschaft Unerklärliches und Unberechenbares unter der Sonne mehr passieren könne, verkündete Ernst Haeckel in seinem berühmten Buch »Die Welträtsel« im Jahre 1900. Der Turm von Babel sollte nun definitiv den Himmel berühren und alle unaufgeklärten Unklarheiten sollten ein für alle Mal beseitigt sein.
In diesem Moment der Weltgeschichte waren sich Atheismus und Wissenschaft so nahe gekommen, dass sie fast miteinander identisch schienen. So nah jedenfalls wie nie zuvor und später nie mehr. Doch dann passierte - die plötzliche Wende. Es war die Wende der Naturwissenschaft mit Quantentheorie, Relativitätstheorie und Urknalltheorie, später dann neue Wissenschaftstheorien wie die Karl Poppers, die der Wissenschaft die Erkenntnis ewiger Wahrheiten grundsätzlich absprachen. Das führte schlagartig zur Zerstörung der zum Teil jahrhundertealten intellektuellen Fundamente des Atheismus. So wie sich Kirche und Wissenschaft nach dem Fall Galilei emotional auseinandergelebt hatten, so war nun plötzlich die Ehe zwischen Atheismus und Wissenschaft argumentativ zerrüttet.
Gerade die führenden Leute der modernen Naturwissenschaft wandten sich wieder der Religion zu. Max Planck, der Begründer der Quantentheorie, beendete seinen berühmten Vortrag über »Religion und Naturwissenschaft« mit dem programmatischen Losungswort »Hin zu Gott!«. Werner Heisenberg wies darauf hin, dass sich die naturwissenschaftliche Erkenntnis notwendigerweise einenge auf einen Teilaspekt der Wirklichkeit, das so genannte Objektive. »Die religiöse Sprache aber muss gerade die Spaltung der Welt in ihre objektive und subjektive Seite vermeiden; denn wer könnte behaupten, dass die objektive Seite wirklicher wäre als die subjektive.« Und wirklich, der methodische Zweifel, das Experiment und der Beweis sind jedem Wissenschaftler zwar die selbstverständlichen Instrumente der Erkenntnis. Aber über die Liebe und Treue seiner Frau wird er sich weder mit methodischem Zweifel noch mit Experimenten oder Beweisen Gewissheit verschaffen - und doch wird dem Wissenschaftler diese Erkenntnis kostbarer und gewisser sein als alles, was er wissenschaftlich erkannt hat. Albert Einstein, der Erfinder der Relativitätstheorie, war zuerst natürlich Atheist geworden. Aber je tiefer er in die Wissenschaft eindrang, desto mehr entwickelte er sich zu einem Bewunderer des Göttlichen: »Seine (des Forschers) Religiosität liegt im verzückten Staunen über die Harmonie der Naturgesetzlichkeit, in der sich eine so überlegene Vernunft offenbart, dass alles Sinnvolle menschlichen Denkens und Anordnens dagegen ein gänzlich nichtiger Abglanz ist.« Der Geist war nicht ein Nebenprodukt der Materie, er war deren beherrschende Struktur. Das erkennende menschliche Denken war nur ein Nachdenken des schon Vorgedachten. Und der Quantenphysiker Pascual Jordan schließlich schrieb in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts den schon erwähnten Bestseller »Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage«. Darin erläuterte er nicht nur das neue naturwissenschaftliche Weltbild, sondern brachte auch ganz unbefangen das Staunen eines modernen Naturwissenschaftlers vor den Wundern der göttlichen Schöpfung zum Ausdruck. Tatsächlich, der renommierte Physiker Pascual Jordan sprach wieder von - Wundern.
Aus: Manfred Lütz, Gott. Eine kleine Geschichte des Größten. Pattloch Verlag, München 2007.
Gaudium Evangelii
1. Freude aus der Frohbotschaft
soll die Christenheit erwecken,
Freude, die den Frieden schafft,
möge euer Tun bezwecken.
Allen Menschen auf der Erden
sei das Heil nun zugesagt,
dass die Vielen offen werden,
auch wenn's Neidern nicht behagt.
Ausgegrenzt darf keiner werden,
der da Menschenantlitz trägt,
weil vorangeht seinen Herden,
der nicht nach Verdiensten frägt.
2. Freude laufe wie ein Feuer
über Bergesgipfel hin.
Jubelt laut, so ist's geheuer,
weil ich voller Hoffnung bin.
Ein Messias kommt zur Erde,
sie erkennen ihn nur nicht.
Seine Art soll unsre werden:
leistet auf die Macht Verzicht.
Mann und Frau die Liebe eine,
werden Gottes Ebenbild,
und nicht fürder jemand weine
dem's am Nötigsten gebricht.
3. Freude, ich ruf nochmals Freude,
werde aller Welt zuteil.
Vertröstet nicht die armen Leute,
mit dem Tand, der euch wohlfeil.
Mit Purpur und den roten Schuhn,
dem Protz ohn jedes Augenmaß,
hat der im Stalle nichts zu tun,
Wie kam's, dass man darauf vergaß?
Freude ist der Menschen Sehnen,
und kein Auge sieht sich satt,
was der Herr bereit hält denen,
die er seit je zu Partnern hat.
Wolfgang Dettenkofer frei nach Schiller; Melodie: Beethovens Europahymne.
Sich Gott überlassen
Sieht der Kontemplative auch keine Fortschritte ..., schreitet er doch weiter, als wenn er sich nur auf eigenen Füßen bewegte. Gott trägt uns in seinen Armen voran. Daher empfinden wir das Schreiten nicht, obgleich wir im Schrittmaß Gottes dahingetragen werden ... Gott ist der Wirkende ... Was er im Innern formt, ist den Sinnen unzugänglich. Es vollzieht sich im Schweigen - wie der Weise sagt: "Der Weisheit Worte werden im Schweigen empfangen" (Koh 9,17). Der Mensch überlasse sich den Händen Gottes. Er liefere sich nicht den eigenen Händen aus.
Quelle: Johannes vom Kreuz in: Die lebendige Flamme. Die Briefe und die kleinen Schriften, Einsiedeln 1964.
Ich bin kalt in der Liebe
Siehe, Herr,
ich bin ein leeres Gefäß,
das bedarf sehr,
dass man es fülle.
Mein Herr, fülle es,
ich bin schwach im Glauben;
Stärke mich,
ich bin kalt in der Liebe.
Wärme mich und mache mich heiß,
dass meine Liebe herausfließe
auf meinen Nächsten.
Ich habe keinen festen, starken Glauben,
und zweifle zuzeiten
und kann dir nicht völlig vertrauen.
Ach Herr, hilf mir,
mehre mir den Glauben und das Vertrauen.
Alles, was ich habe,
ist in dir beschlossen.
Ich bin arm,
du bist reich
und bist gekommen,
dich der Armen zu erbarmen.
Ich bin ein Sünder,
du bist gerecht.
Hier bei mir ist die Krankheit der Sünde,
in dir aber ist die Fülle der Gerechtigkeit.
Darum bleibe ich bei dir,
dir muss ich nicht geben;
von dir kann ich nehmen.
Quelle: Martin Luther, WA 10 I, S. 438.
Unauffällig
Wie deutlich würde sich die Anwesenheit des Geistes in dem Augenblick zeigen, wenn er unserer Welt entzogen würde. Sie wäre ein Land, aus dem das Wasser verschwindet. Das Wasser fiel nicht auf; doch wenn es weg ist, ist alles anders. Blühende Felder werden zu staubigen Wüsten.
Wenn die Kirche zum Heiligen Geist betet, bedient sie sich in der Tat eines solchen Vergleiches. Sie wählt aus dem Psalm 104 ein Wort aus, in welchem die Lebenskraft der Natur "Gottes Atem, Gottes Geist" betitelt wird. Durch ihn bestehen alle lebenden Wesen. "Verbirgst du dein Angesicht, so vergehen sie in Furcht, nimmst du ihnen den Odem, so sterben sie hin und sinken zurück in den Staub; du sendest aus deinem Geist, und sie werden geschaffen, und das Angesicht der Erde machst du neu." (Psalm 104, 29f.)
Quelle: aus dem holländischen Erwachsenenkatechismus.
Sympathisches Gotteslob
Liebe Gemeinde, sagte der altgewordene Pfarrer beim Abschied, wir haben keinen Kirchturm gebaut, keine Orgel, keine Kegelbahn. Ich hinterlasse euch auch keinen interessanten Kontostand in der Pfarrkasse, denn ihr wisst ja selber, wie oft an unserer Pfarrhaustür gebettelt wurde in den Jahren. Wenn ihr später euren Kindern von unserer Zeit erzählt, müsst ihr vielleicht in euren Wohnungen zusammensitzen, denn die Kirche war nicht mehr zu renovieren in diesem Zustand. Und wir hatten nichts dafür auf die hohe Kante gelegt.
Tränen standen ihm in den Augen, als die türkischen Mädchen ihm ein Tanzlied vorführten, wie sie es immer hatten tun dürfen im Altarraum, der freitags mit Teppichen ausgelegt war. Man sah auch etliche Männer weinen, als der Alte die Geige ans Kinn legte und eine seiner Country-Melodien spielte. Passt auf, wenn jemand in den Akten nach euren Ehen guckt. Er lachte, und manche wurden rot, denn seit Jahren hatte der Alte keine Genehmigungen mehr eingeholt. Der Herr Dekan lächelte verlegen, denn was sollte man da schon sagen.
Tags darauf kam ein Möbelpacker. Die wenigen Habseligkeiten gingen mit ins Altersheim. Dann kamen die Zivis von der Caritas, um den Rest ins Übergangswohnheim zu schaffen. Ja, so war es. Falls es irgendwo so war.
Quelle: Michael Graff in: Christ in der Gegenwart 1990 (42. Jg), S. 136.
Mein Herr, mein Erlöser
Herr, du hast Worte ewigen Lebens, du bist Speise und Trank, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist das Licht, das in der Dunkelheit scheint, die Lampe auf dem Leuchter, die Stadt auf dem Berge. In dir und durch dich kann ich den himmlischen Vater sehen, und mit dir kann ich den Weg zu ihm finden. Sei du mein Herr, mein Erlöser, mein Weggefährte, meine Freude und mein Friede.
Quelle: Henri Nouwen in: "Zeig mir den Weg", Freiburg 2002.
Nagelprobe für den Gottesglauben
An Auferweckung glauben heißt nicht, an irgendwelche unverifizierbare Kuriositäten zu glauben, heißt überhaupt nicht, zum Glauben an Gott noch etwas "dazu" glauben zu müssen. Nein, der Auferweckungsglaube ist kein Zusatz zum Gottesglauben; er ist geradezu die Radikalisierung des Gottesglaubens, die Nagelprobe, die der Gottesglaube zu bestehen hat. Warum? Weil ich mit meinem unbedingten Vertrauen nicht auf halbem Wege anhalte, sondern ihn konsequent zu Ende gehe. Weil ich diesem Gott alles, eben auch das Allerletzte, den Sieg über den Tod zutraue. Weil ich vernünftigerweise darauf vertraue, dass der allmächtige Schöpfer, der aus dem Nichtsein ins Sein ruft, auch aus dem Tod ins Leben zu rufen vermag. Weil ich dem Schöpfer und Erhalter des Kosmos und des Menschen zutraue, dass er auch im Sterben über die Grenzen alles bislang Erfahrenen hinaus noch ein Wort mehr zu sagen hat; dass ihm wie das erste so auch das letzte Wort gehört, dass er wie der Gott des Anfangs auch der Gott des Endes ist: Alpha und Omega. Wer so ernsthaft an den ewig lebendigen Gott glaubt, glaubt dann auch an Gottes ewiges Leben, glaubt auch an sein - des Menschen - ewiges Leben.
Quelle: Hans Küng in: Ewiges Leben, München 1982.
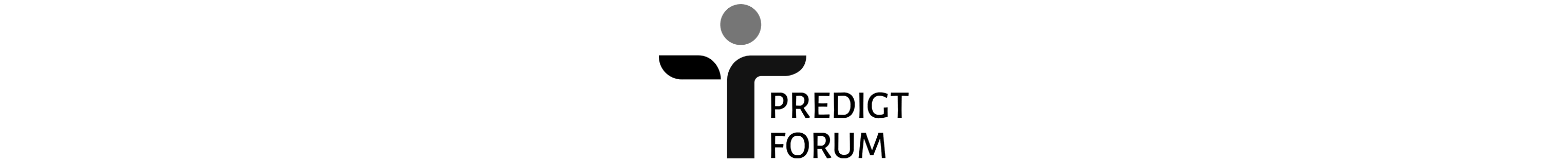
Bernhard Zahrl (2011)
Martin Leitgöb (2005)
Gerhard Gruber (1999)