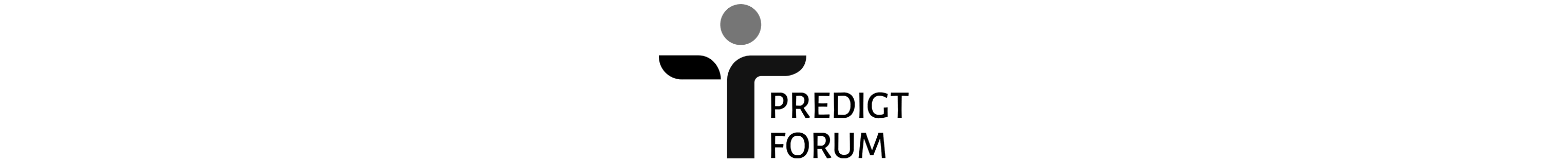Kommunikation im Wandel oder im Untergang?
Jede und jeder von uns ahnt oder weiß, was ein Smartphone ist. Denn egal, in welche Medien man schaut: Man stößt überall auf Werbung für die neusten Geräte. Fragt man allerdings herum, wer mit einem Smartphone umgehen kann, werden die Stimmen schon leiser. An manchen Orten erntet ein müdes Lächeln, wer sagt, er wolle mit einem Handy eigentlich nur telefonieren können. Denn das ist schon lange out. Ein modernes Smartphone ist eigentlich ein Taschenbüro - mit fast genauso vielen Möglichkeiten wie ein Großraumbüro. Und schließlich kann man damit sogar auch noch telefonieren. Muss man aber nicht - denn es gibt ja auch diese diversen Chatprogramme und andere Software für die Online-Kommunikation.
Ihnen raucht jetzt der Kopf, Sie finden das alles ziemlich schrecklich und wollen nach Möglichkeit wenig von dieser Technik wissen? Dann sind Sie vermutlich - gemäß Statistik - eine KirchenbesucherIN, älter als 55 Jahre. Bei Jüngeren ist ein Leben ohne Smartphone fast nicht mehr möglich. Wenn ich mit Skeptikern gegenüber dieser Technik ins Gespräch komme, ist oft Ähnliches zu hören: “viel zu kompliziert!” und: “das macht doch einsam, die gucken ja nur noch in ihr Display”.
Tatsächlich kann man vielerorts einen Trend zu dieser Extremsituation erkennen. So erlebt vor einiger Zeit in der chinesischen Millionenmetropole Beijing: Wenn man dort eine U-Bahn betritt, ist diese höchstwahrscheinlich brechend voll - und dennoch ist es in dem Zug mucksmäuschenstill. Die Leute sind nämlich fast ausnahmslos intensiv mit ihren Smartphones beschäftigt. Gesprochen wird nahezu nicht - selbst wenn Passagiere als Familie oder sonst wie zusammen gehören.
Geht auch ohne App: Beten
Man muss vorsichtig sein mit allzu schneller Verurteilung. Denn allein die einsame Kommunikation via Technik mit einer Person im Nirgendwo kann noch nicht der Verfall menschlicher Gesellschaft bedeuten. Dann hätte dieser Verfall nicht erst heute eingesetzt, sondern schon längst - etwa zu biblischen Zeiten. Hörten wir doch gerade, wie Jesus den Menschen sagt, “dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten”. Zu einer unablässigen Kommunikation nicht mit einem anderen Menschen und nicht mit technischen Hilfsmitteln, sondern mit Gott direkt fordert der Menschensohn auf.
Dieses einsame und intensive Zwiegespräch mit unserem Gott sieht Jesus als eine Grundbedingung an, ohne deren Erfüllung die Beziehung der Menschen zu ihrem Gott nicht funktionieren kann. Etliche biblische Zeugnisse zeigen uns auf, wie Jesus selbst dieses Zwiegespräch gründlich gepflegt hat. Immer wieder zieht er sich von den Menschen zum Gebet zurück, zuletzt noch kurz vor seinem Leidensweg am Ölberg.
Aus der Tiefe des Herzens
In dem Evangelium von heute ruft die Jesus die Menschen auf, ihre Not im Gebet Gott anzuvertrauen. Als Christinnen und Christen gehört das Gebet zu unserem selbstverständlichen Glaubensvollzug dazu. Immer wieder erzählen auch Menschen, die sich selbst als kirchenfern bezeichnen, dass das Gebet in ihrem Leben sehr wohl seinen Platz hat. Neben dem gemeinschaftlichen oder dem stellvertretenen Gebet in der Liturgie gibt es bekanntlich vielfältige Formen der Zwiesprache mit Gott: das laute Klagen und Bitten, zu dem Jesus uns heute einlädt; das herzliche Danken, wenn es mal wieder gut gegangen ist im Leben; der von Herzen kommende Stoßseufzer, der viele Gründe haben kann; das Bittgebet, mit dem wir vor Gott für Andere eintreten wie Mose für sein Volk - so hörten wir es ja soeben in der Lesung; das meditative Beten wie etwa das Rosenkranzgebet, bei dem wir uns auf die Fürsprache der Gottesmutter in Beziehung zu Gott begeben.
Das Gebet kennt also viele Situationen - nicht nur die Klage. Immer wieder erleben wir leider auch, wie Menschen das Gebet missbrauchen in Form von Demonstrationen gegen Situationen, die diesen Menschen nicht passen. Dann müssen wir sehen, wie christliche Fanatiker und Fundamentalisten weit abkommen von dem, was Zwiesprache mit unserem Gott eigentlich sein soll. "Macht es nicht wie die Heuchler" - der Satz aus der Matthäus-Perikope, die wir immer am Aschermittwoch hören, klingt noch in unseren Ohren nach.
Bete und arbeite
Wer sich immer wieder zum Gebet zurückzieht, weil er in Ruhe und im Alleinsein am besten zu seinem Gott findet, der gleicht bald einmal den vielen Smartphone-Besitzern, von denen ich eingangs erzählte. Aber ähnlich wie jener, der fleißig chattet, befindet sich auch der Beter in einem Austausch. Tief in sich will er die Antworten, die Gott auf sein Klagen, Danken und Bitten gibt, erleben. Aber ähnlich wie der allzu intensive Chatter soziale Beziehungen verlernen kann, ist das auch für den Menschen möglich, der nichts mehr macht als beten. Der Grad zwischen tiefgründig gelebter Gottesbeziehung und Weltflucht ist schmal. Schon darum hat etwa der hl. Benedikt seine Brüder sowohl zum Gebet wie auch zur Arbeit aufgefordert. Die Verkündigung des heutigen Sonntags lädt uns alle ein, das rechte Maß zu finden. Die Texte rufen uns auf, die Welt in der wir leben, tatkräftig zu gestalten und die Beziehung zu unserem Gott aus ganzem Herzen zu leben.
Genau das erwarten übrigens auch die Partner der diesjährigen Weltmissionsaktion in Malawi von uns. Natürlich wissen wir uns wohl über alle Landes-, Kultur- und Sprachgrenzen hinaus auch im Gebet mit den Menschen in Ostafrika verbunden - zurecht aber erhoffen sie auch unsere tatkräftige Unterstützung. Mission meint schließlich immer das gleichzeitige Ausgespanntsein zwischen Gott und Mensch. Dass wir das ernst nehmen, darauf setzen all jene, die in den Missionsprojekten arbeiten. “Dem Glauben Hände geben” - so das Motto des diesjährigen Weltmissionssonntages: Und Hände kann man bekanntlich falten zum Gebet oder zur Arbeit bewegen.